Cyberangriffe sind längst kein Ausnahmefall mehr – sie gehören zum Alltag nahezu jeder Branche. Viele Unternehmen sind überzeugt, in Sachen IT-Security gut aufgestellt zu sein.
Doch wenn der Ernstfall eintritt, zeigt sich oft: Die eigentlichen Schwachstellen liegen nicht in fehlender Technologie, sondern in nicht gelebten Prozessen. Aktuelle Studien zeigen: Es dauert im Schnitt 137 Tage, bis eine bekannte Schwachstelle geschlossen wird. Angreifer hingegen benötigen im Zweifel nur 5 Tage für eine erfolgreiche Ausnutzung. Wer auf Einzelmaßnahmen oder Tools ohne durchgängige Abläufe setzt, riskiert mehr als Sicherheitslücken: Reputationsverluste, Betriebsunterbrechungen und regulatorische Konsequenzen sind reale Folgen.
Die folgenden zehn Indikatoren zeigen, wo im Schwachstellenmanagement besonders häufig strukturelle Defizite auftreten, und was Unternehmen tun können, um sie zu beheben. Besonders wichtig dabei: Die Rolle des Vulnerability Managers – nicht als Tool-Anwender, sondern als gestaltende Instanz im Spannungsfeld von Technik, Governance und Umsetzung.
#1 Schwachstellen bleiben monatelang unbearbeitet.
Wenn Schwachstellen über längere Zeit bestehen bleiben, obwohl sie bekannt sind, fehlt häufig ein klar strukturierter Prozess zur Bewertung und Behebung. Solche „Langläufer“ entstehen durch mangelnde Priorisierung, fehlende Verantwortlichkeiten oder unzureichende Tool-Integration. Ein zentrales Vulnerability Management mit automatisierter Bewertung, verbindlichen Fristen und Nachverfolgung schafft hier Abhilfe – vorausgesetzt, es wird prozessual verankert und aktiv gesteuert.
#2 Serverprozesse sind nicht auf Effizienz und Sicherheit ausgelegt.
Server sind das Rückgrat der IT, doch viele Prozesse dort sind historisch gewachsen und schlecht synchronisiert. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlkonfigurationen und verzögert die Reaktion auf Schwachstellen. Wer regelmäßige Reviews zu Systemhärtung, Rechtevergabe und Patch-Routinen durchführt, schafft nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Stabilität – und reduziert die operative Last langfristig.
#3 Das Patchmanagement weist systematische Lücken auf.
Patchmanagement ist kein technisches Thema, sondern ein organisatorisches. Immer wieder scheitert es daran, dass Systeme nicht vollständig eingebunden, Zuständigkeiten unklar oder Prozesse zu langwierig sind. Es braucht automatisierte Patchprozesse mit regelmäßiger Berichterstattung, sauberer Dokumentation und klaren Regeln für Ausnahmen. Hier wird sichtbar: Ein funktionierender Prozess entsteht nicht durch das Tool allein – sondern durch klare Verantwortung und Governance.
#4 Die Systeminventarisierung ist unvollständig.
Nur was bekannt ist, lässt sich schützen. Ohne vollständige und aktuelle Übersicht über Assets, Applikationen und Endpoints bleiben Risiken unerkannt. Automatisierte Lösungen zur Erfassung und Korrelation mit Schwachstellendaten sind unverzichtbar, doch auch hier gilt: Die beste Technik wirkt nur, wenn ein Prozess dahintersteht.
#5 Änderungen und Audits lassen sich nicht nachvollziehen.
Dokumentation ist mehr als ein Compliance-Thema – sie ist ein zentraler Bestandteil resilienter Prozesse. Ob KRITIS, NIS2, DORA oder das IT-Sicherheitsgesetz: Alle fordern lückenlose Nachweise über sicherheitsrelevante Änderungen. Wer Patch- und Assetdaten nicht strukturiert verknüpft, läuft Gefahr, im Auditfall nicht nachweisen zu können, wann welche Risiken behandelt wurden.
#6 Interne Abläufe bremsen die Schwachstellenbehebung aus.
Nicht selten liegt die Ursache für unbearbeitete Schwachstellen in der Organisation selbst: Fehlende Abstimmung zwischen Fachbereichen, manuelle Schnittstellen oder unklare Eskalationswege verzögern die Umsetzung. Ein wirksames Vulnerability Management ist immer auch Change Management – mit definierten Rollen, klaren Zuständigkeiten und regelmäßigen Prozess-Reviews.
#7 Dienstleister erhalten nicht die relevanten Informationen.
In vielen Fällen übernehmen externe Partner Aufgaben im Schwachstellenmanagement, doch ohne gezielten Informationsaustausch entstehen Verzögerungen und Missverständnisse. Wichtig ist ein rollenbasiertes Export-Management, das nur die Daten bereitstellt, die der jeweilige Dienstleister benötigt – strukturiert, aktuell und nachvollziehbar.
#8 Die Prozesse sind nicht durchgängig dokumentiert.
Ein professionelles Schwachstellenmanagement endet nicht beim Scan. Es umfasst die gesamte Kette: von der Identifikation über die Bewertung und Umsetzung bis zur Verifikation. Ohne dokumentierten End-to-End-Prozess entsteht schnell Intransparenz und Verantwortung diffundiert. Struktur ersetzt hier nicht den Menschen, aber sie gibt ihm die Werkzeuge, um wirksam zu handeln.
Vulnerability Management ist mehr als ein Scan, es ist eine Disziplin.
Patrick Schäfers, Arvato Systems
#9 Erfolg wird nicht gemessen.
Ohne Messbarkeit bleibt jede Verbesserung zufällig. Wer nicht weiß, wie lange eine Behebung dauert oder wie viele Schwachstellen pro Quartal geschlossen wurden, kann den eigenen Fortschritt nicht bewerten, geschweige denn steuern. Kennzahlen wie MTTR (Mean Time to Remediate), offene Schwachstellen pro System oder Schließrate pro Monat sollten in jedem Dashboard sichtbar sein.
#10 Prozesse werden nicht an neue Bedrohungen angepasst.
Die Bedrohungslage entwickelt sich ständig weiter und damit auch die Anforderungen an ein dynamisches Schwachstellenmanagement. Wer seine Abläufe nicht regelmäßig überprüft und anpasst, verliert den Anschluss. Quartalsweise Reviews, die Einbindung von Zero-Day-Lagen und regulatorischen Änderungen sowie der Einsatz von externen Spezialisten zur Ergänzung interner Ressourcen sind essenziell.
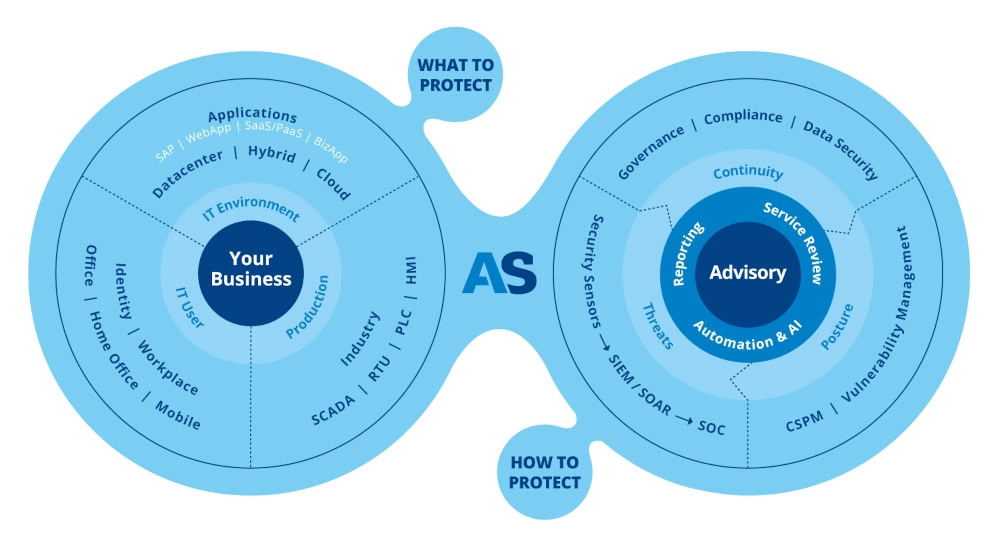
Fazit: Kein Tool ersetzt ein starkes Prozessfundament
Viele Organisationen setzen auf technische Lösungen und übersehen dabei die wichtigste Stellschraube: den Prozess. Vulnerability Management ist mehr als ein Scan, es ist eine Disziplin. Es braucht Verantwortlichkeit, strukturierte Abläufe, messbare Ergebnisse und einen Vulnerability Manager, der diese Disziplin professionell steuert. Wenn Sie sich in mehreren der Punkte wiedererkennen, ist das ein Signal, dass Handlungsbedarf besteht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Ihre Prozesse zu justieren und das Steuer zu übernehmen. Denn in der IT-Security zählt nicht, ob ein Angriff kommt – sondern, wie gut Sie vorbereitet sind.












