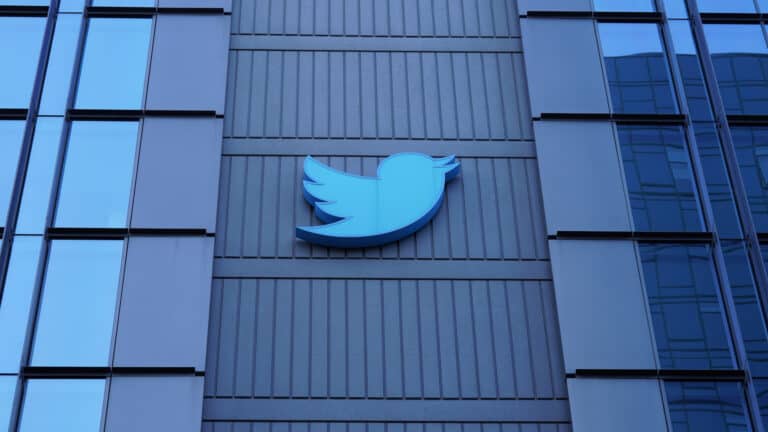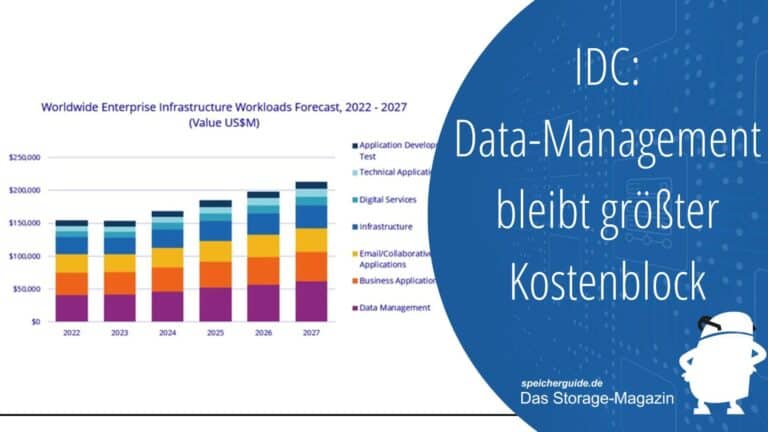Snake Ransomware: Maschinenidentitäten als ungewollte Einfallstore
Nach dem mehr Informationen, über die vom US-Justizministerium zu Beginn des Monats aufgedeckte Snake Ransomware veröffentlicht werden, scheinen die Cyberkriminellen in eine Falle geraten zu sein. Sie haben nämlich die Grundlagen des Maschinenidentitätsmanagements vernachlässigt. Das CISA Advisory veröffentlichte einen Bericht, der darauf schließen lässt, dass die OpenSSL-Bibliothek, die die Gruppe für den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch genutzt hat, eine erhebliche Schwachstelle aufwies.