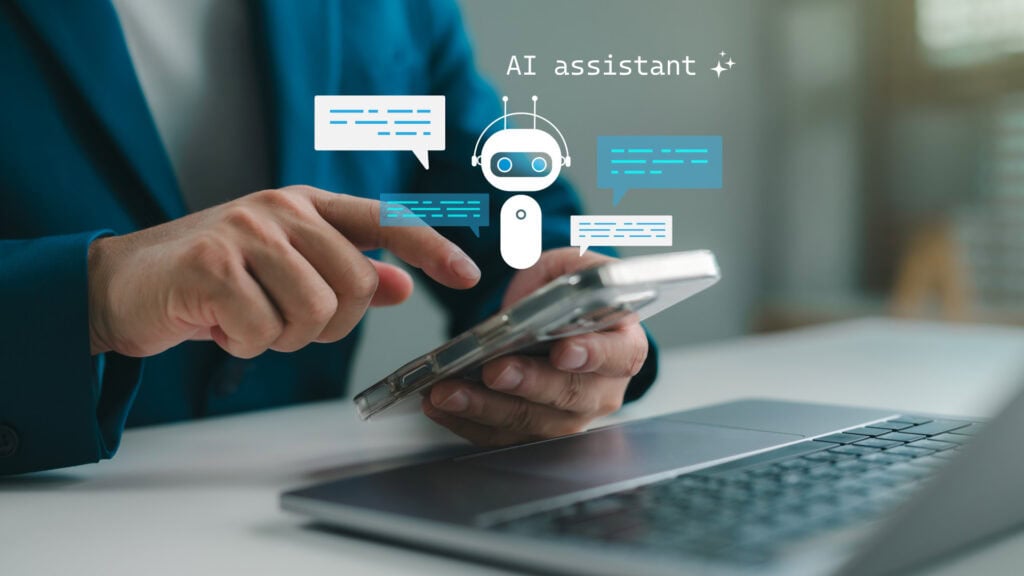Eigenbau eines KI-Chatbots mit No-Code Bot-Builder-Tools ist mittlerweile möglich und kann sich in einigen Fällen lohnen. Der DIY-Ansatz stößt aber schnell an seine Grenzen.
Mit nur einigen Klicks funktioniert es eben doch nicht, wenn die Anforderungen etwas höher sind.
Zwei Faktoren sind es, deretwegen generative KI als Quantensprung wahrgenommen wird: zum einen die Fähigkeiten von Large Language Models, zum anderen die Möglichkeit der Kommunikation. Schnittstelle zum Menschen ist der Chatbot. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Tools, mit denen sich angeblich KI-Assistenten ganz ohne Programmierkenntnisse bauen lassen sollen, nur per Drag and Drop. Allein: Einen professionellen KI-Agenten zu erstellen, funktioniert damit noch nicht. Die technischen und organisatorischen Herausforderungen sind eben doch größer und allein mit „Do-it-yourself“-Ansätzen funktioniert es nicht.
Ein KI-Agent ist mehr als ein Chatbot
Chatbots oder Voice Assistants laden auf vielen Webseiten heute zum Dialog ein. KI-Agenten im eigentlichen Sinne sind dies aber noch nicht. Solche können darüber hinaus eigenständig handeln. Über APIs sind sie mit Werkzeugen verbunden, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie verfügen über Gedächtnisstrukturen, um Kontext herzustellen und eine Autonomie-Logik, die sie dazu befähigt, Entscheidungen ohne Eingriff des Menschen zu treffen. Und schließlich ist in ihnen ein Large Language Model zur Sprachverarbeitung hinterlegt.
Langflow, BotBuilder oder Zapier Chatbots sind die Namen von No-Code-Anwendungen, die den Selbstbau solcher KI-Agenten versprechen. Einige verfügen über die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen, auf Basis derer der Assistent spezifische Fragen zum Unternehmen oder bestimmten Prozessen beantworten kann. Über Automatisierungstools wie Zapier, n8n oder Make lassen sich die selbst erstellten Assistenten an weitere Tools anbinden, zum eigenhändigen Verschicken von E-Mails etwa oder zum Erstellen von Kalendereinträgen. Diese Anbindungen sind oft innerhalb kürzester Zeit aufgesetzt und sparen dadurch teure Entwicklungskosten.
Verbindung zu Nicht-Standard-Tools aufwändig
Mit den genannten Fähigkeiten erleichtern No-Code-Tools zunächst den Einstieg. Bei intensiverer Befassung mit der Materie und etwas komplexeren Anwendungsszenarien aber ist schnell das Ende ihrer Leistungsfähigkeit erreicht. Zum Beispiel wenn es um komplexe Schnittstellenintegration geht. Weichen die Software oder Tools, auf die der Agent zugreifen soll, vom Standard ab, gibt es oft keine passenden APIs bzw. Schnittstellen, über die der Agent kommunizieren könnte. Umständliche Workarounds, oft verbunden mit hohen Kosten, sind erforderlich, um doch eine Anbindung herzustellen. Dazu wiederum sind Expertise und erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler notwendig. Fehlen Sie, droht eine Endlosschleife aus Bugs, Debugging und Frustration.
Eine weitere Achilles-Ferse ist die Sicherheit: DSGVO, ISO-Standards und interne Compliance-Vorgaben sind insbesondere in regulierten Branchen zu beachten. Sie können es unter Umständen ausschließen, unternehmensinterne Dokumente auf eine Anbieterplattform hochzuladen. Weil sich APIs verändern und Modelle veralten, entstehen schnell Sicherheitslücken. Werden sie nicht laufend gewartet und weiterentwickelt, sind Do-it-yourself-Bots daher ein ständiges Sicherheitsrisiko. Zudem hat man bei Drittanbietern keinen Einfluss auf Änderungen. So ist möglich, dass sich der Agent von heute auf morgen anders verhält, als ursprünglich erstellt.
Harte Landung nach ersten Erfolgen
Wo die Fallstricke lauern, zeigt das Beispiel eines mittelständischen Autohauses. Es wollte seinen telefonischen Kundenservice entlasten, der zusätzlich zur Arbeit im Verkauf und der Werkstatt Telefonanfragen zu Öffnungszeiten und Terminbuchungen beantworten musste. Einer der technisch versierten Kollegen setzte mit einem No-Code-Tool in kurzer Zeit einen Voice-Assistenten auf. Die Telefonnummer war schnell angebunden, die es ersten Tests verliefen vielversprechend: Einfache Fragen wurden beantwortet, Kundendaten zuverlässig erkannt.
Schon bei der Einbindung des selbstentwickelten Terminbuchungssystems hakte es jedoch, denn hier kam es sofort zur beschriebenen Schnittstellenproblematik. So konnte der Agent zwar einfache Fragen beantworten, aber nichts in den Kalender eintragen – was die eigentliche Entlastung gewesen wäre. Erst mit Hilfe einer auf die Entwicklung von KI-Agenten spezialisierten Agentur gelang es schließlich, eine maßgeschneiderte Lösung mit allen gewünschten Integrationen zu schaffen.
Fazit: Eigenbau lohnt sich nur bei begrenzten Anforderungen
No-Code-Plattformen zum Bau eines Agenten können sinnvoll sein, wenn sich dieser in der Funktion beschränkt: Er soll einfache Fragen zum Unternehmen beantworten und gebräuchliche Tools über Standardschnittstellen anbinden können. Es sollten außerdem keine vertraulichen Daten in die Cloud des Drittanbieters hochgeladen werden müssen. Wer nicht unbedingt auf Self-Hosting Wert legt, nur ein begrenztes Budget hat und zudem noch etwas interne IT-Expertise, für den mag Do-it-yourself zunächst funktionieren. Kommen jedoch hohe Sicherheitsanforderungen, komplexe Integrationen oder Skalierungsfragen hinzu, braucht es in den allermeisten Fällen Unterstützung durch einen professionellen IT-Dienstleister.
Autorin: Ramona Kühn, Solution Expert AI bei der handz.on GmbH