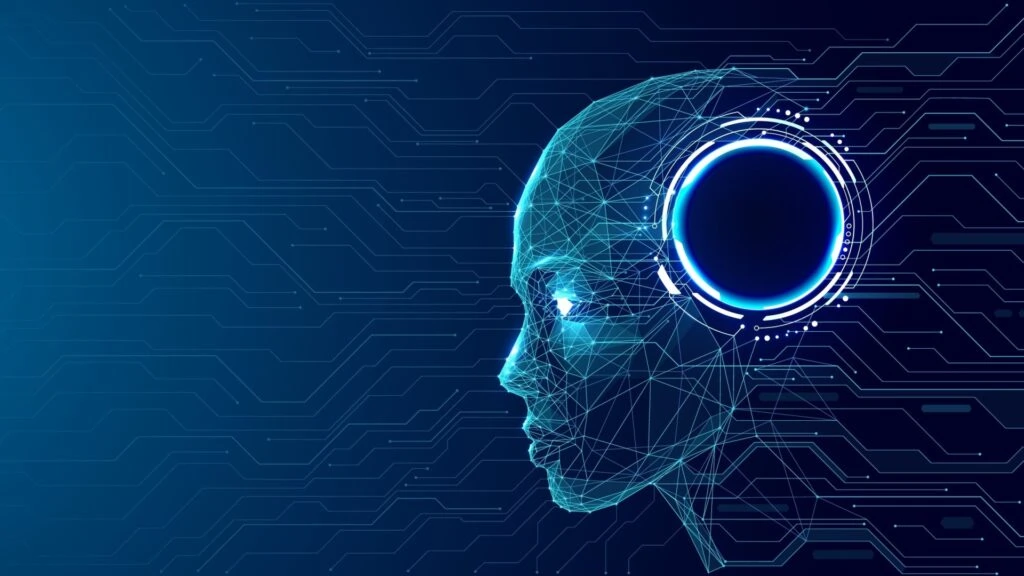Viele Unternehmen erleben aktuell ein Déjà-vu: Ähnlich wie damals bei Business Process Management (BPM) oder Robotic Process Automation (RPA) drohen auch beim Einsatz von generativer KI typische Anfangsfehler. Kurt Petersen, SVP Customer Success bei Camunda beschreibt drei entscheidende Stolpersteine, die vermieden werden sollten – damit generative KI nicht in der bekannten „Pilotenfalle“ stecken bleibt.
Über alle Branchen hinweg integrieren Unternehmen mit Hochdruck KI in ihre Abläufe. 84 Prozent der Unternehmen planen, in den nächsten drei Jahren zusätzliche KI-Funktionen einzuführen. Von Chatbots im Kundenservice bis zu KI-Copilots kommt die Zukunft schneller, als viele erwarten. Doch in ihrem Streben nach schnellen Erfolgen übersehen viele Führungskräfte eine harte Wahrheit, denn die Geschichte wiederholt sich. Ähnliche Fallstricke, die schon frühere Automatisierungsbemühungen in Unternehmen aufgehalten haben, tauchen erneut auf. Unternehmen laufen bei der Organisation ihrer IT erneut Gefahr, dieselben kostspieligen Fehler zu wiederholen.
Von starren Business Process Management (BPM)-Tools der ersten Generation bis hin zur Robotic Process Automation (RPA) war das grundlegende Problem dasselbe: isolierte Automatisierung. Insellösungen, unflexible Logik und fehlende Orchestrierung machten viele Automatisierungslösungen zu langfristigen Belastungen und Ursachen für technische Schulden.
Bleiben Unternehmen unachtsam und wiederholen diese Fehler bei der Nutzung von KI, geschieht das diesmal jedoch in großem Maßstab, in Echtzeit und unter dem wachsamen Blick von Regulierungsbehörden und Kunden. Hier sind drei der größten Automatisierungsfehler und Handlungsempfehlungen wie man sie in Zukunft mit KI vermeiden kann:
1. Fehler: Schnellen Erfolgen hinterherjagen
Jede Technologie, die auf schnellem Wege Resultate verspricht, sollte mit einem Warnhinweis versehen werden. In der Vergangenheit versprach RPA beispielsweise, sich wiederholende Aufgaben mit minimalem IT-Aufwand zu automatisieren. Manche Szenarien sparten kurzfristig Zeit, skalierten im Anschluss jedoch nicht. Allzu oft liefen RPA-Bots in Abteilungs-Silos, ohne durchgängige Transparenz oder zentralisierte Kontrolle.
Das Problem? Technologien wie RPA benötigen Orchestrierung. Ohne diese werden sie zu taktischen Maßnahmen – anfällig, reaktiv und schwer zu steuern. IT-Teams warten oft Systeme, die längst automatisiert funktionieren sollten.
2. Fehler: In Silos automatisieren
Automatisierungssilos sind nach wie vor ein weit verbreitetes Problem in vielen Unternehmen. In der Frühphase setzten unterschiedliche Teams unterschiedliche Tools für unterschiedliche Aufgaben ein – RPA im operativen Bereich, iPaaS im Kundensupport, Legacy-BPM in der Finanzabteilung. Jeder Einsatz beseitigte lokale Ineffizienzen, doch ohne eine gemeinsame Geschäftsprozessarchitektur oder Governance funktionierten diese Initiativen selten zusammen.
Das Ergebnis: Operative Ineffizienz und Prozesse, die zusammenbrachen. Sobald IT-Verantwortliche wegen aktualisierter Regulatorik oder einer Systemmigration bestehende Strukturen anpassen wollten, musste jede „Insel“ unabhängig voneinander neu konfiguriert werden.
Die Lehre daraus? Automatisierung kann nicht zielgerichtet funktionieren, sofern Unternehmen die Lösungen nicht unternehmensweit skalieren. Bei KI ist es nicht anders: Nur mit einer zentralen Orchestrierungsebene, die Menschen, Systeme, Geräte und neue Technologien wie KI-Agenten miteinander verbindet, wird das Flickwerk einzelner Automatisierungssilos überwunden.
3. Fehler: Mit starren Grundlagen starten
Während der BPM-Welle Anfang der 2000er Jahre konzentrierten sich viele Unternehmen auf die Dokumentation von idealen Arbeitsabläufen. Die eingesetzten BPM-Tools zwangen sie jedoch in starre Geschäftsprozesse, die sich letztlich nicht an veränderte Anforderungen anpassen ließen.
Diese Unflexibilität wurde zu einer Innovationsbremse, sobald sich bestimmte Rahmenbedingungen änderten. Wenn Teams ein neues Produkt auf den Markt brachten, die Customer Journey ändern oder auf neue Vorschriften reagieren mussten, überarbeiteten sie oft ganze Geschäftsprozesse von Grund auf. Ähnlich können heute KI-Tools zu einer Belastung werden, wenn sie sich nicht mit Ihrem Unternehmen weiterentwickeln können. Dieser Fall tritt ein, wenn die Technologien sich nicht skalieren lassen, bei Veränderungen versagen oder sogar unternehmerische Risiken in sich bergen.
Der bessere Weg ist komponierbar und dynamisch. Prozesse sollten modelliert, aber auch ausführbar sein. KI-Agenten sollten innerhalb anpassungsfähiger Rahmenwerke für die Modellierung und Gestaltung von Geschäftsprozessen operieren, die Governance, Transparenz, Flexibilität für KI-basierte Entscheidungsfindung und kontinuierliche Verbesserung unterstützen.
Automatisierungsfehler im Rückspiegel: Lehren für die KI-Einführung im Unternehmen
Das Muster in all diesen Beispielen ist klar: Automatisierung allein ist fragil. KI bildet da keine Ausnahme.
Um diese Probleme in Zukunft zu vermeiden, muss KI von Anfang an in orchestrierte, beobachtbare und steuerbare Geschäftsprozesse integriert werden. Wo Automatisierung ohne Koordination ausgerollt wird, steigt der Wartungsaufwand, die Vorhersagbarkeit sinkt und Veränderungen werden teurer. Die bekannten Fehler waren nie auf mangelnden Ehrgeiz oder fehlende Investitionen zurückzuführen, sie waren schlicht architektonischer Natur.
Damit KI ihr Potenzial entfalten kann, sollten Unternehmen diese Lektionen proaktiv anwenden. Das beginnt damit, KI als Teil einer umfassenderen Geschäftsprozessarchitektur zu betrachten: eine derartige Architektur ist modellierbar, orchestriert, anpassungsfähig, skalierbar und arbeitet regelbasiert.
Orchestrierung bringt Ordnung in die Komplexität KI-gestützter Abläufe. Sie verbindet menschliche Aufgaben, bestehende Technologien sowie KI-Anwendungen zu einem durchgängigen Geschäftsprozess. Damit können Teams den gesamten Prozess beobachten, nachvollziehen, warum ein KI-System eine bestimmte Entscheidung getroffen hat und bei Bedarf eingreifen. Vor allem aber bietet Orchestrierung die notwendigen Leitplanken, die schnelllebige Technologien wie KI unbedingt erfordern.
Ohne Orchestrierung bleibt KI nur ein weiteres isoliertes Werkzeug – fehleranfällig, schwer zu verwalten und abgekoppelt von den geschäftskritischen Ergebnissen, auf die es ankommt. Wenn Unternehmen KI über Prototypen und Pilotprojekte hinaus sicher und strategisch im gesamten Unternehme operationalisieren wollen, dürfen nicht dieselben Fehler wie mit Automatisierungsbestrebungen wiederholt werden.