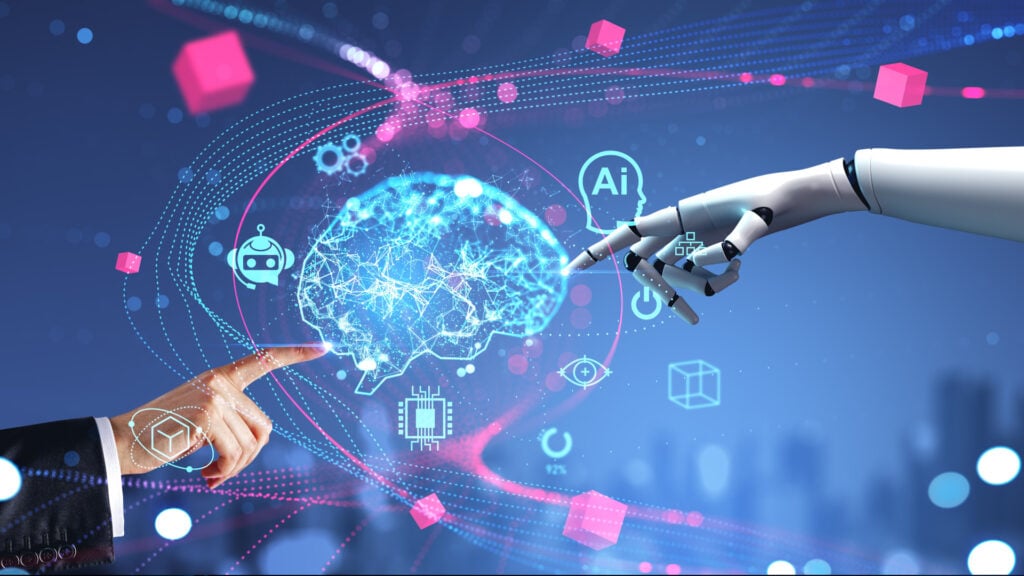Künstliche Intelligenz hat in deutschen Unternehmen längst Einzug gehalten – doch die Ergebnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück.
Laut einer aktuellen Studie des Technologieberatungsunternehmens Slalom erleben viele Organisationen zwar erste Automatisierungserfolge, kämpfen jedoch mit fehlerhaften Ergebnissen, fehlender Integration und unklaren Strategien.
Ernüchterung nach dem KI-Hype
Trotz der Euphorie rund um Chatbots und Automatisierung berichten 62 Prozent der befragten deutschen Unternehmen, dass KI-Modelle in den vergangenen zwölf Monaten unzuverlässige oder verzerrte Resultate geliefert haben. Fast die Hälfte bezweifelt, dass die Technologie bisher die versprochene Produktivitätssteigerung gebracht hat.
Ein weiteres Problem: Viele Systeme lassen sich nur schwer in bestehende Workflows einbinden. Rund 39 Prozent der Befragten beklagen eine mangelnde Integration oder eingeschränkten Zugriff auf KI-Werkzeuge.
Laut Dr. Stephan Theis von Slalom Germany liegt die Ursache häufig in der Datenbasis. Ohne hochwertige, strukturierte und verknüpfte Daten könnten auch die modernsten Modelle keine verlässlichen Ergebnisse liefern. Doch viele Unternehmen investieren zu wenig in Datenqualität und Plattformarchitektur – das Fundament jeder erfolgreichen KI-Anwendung.
Automatisierung ja – Innovation kaum
Die größten Fortschritte zeigen sich bislang in klar abgegrenzten Routineaufgaben. Etwa 70 Prozent der Unternehmen berichten, dass KI manuelle Tätigkeiten reduziert hat. Doch wenn es um strategische oder kreative Bereiche geht, bleibt der Effekt überschaubar: Nur rund ein Drittel der Befragten hat durch KI neue Geschäftsmodelle oder Produkte entwickelt.
Auch qualitative Verbesserungen halten sich in Grenzen. Weniger als die Hälfte der Unternehmen spricht von besseren Ergebnissen oder einer schnelleren Entscheidungsfindung.
Theis und sein Kollege Andrei Svirida sehen die Ursache in zu kleinteiligen Projekten. Viele Unternehmen konzentrierten sich auf isolierte Anwendungen statt auf skalierbare Plattformen, die langfristig Innovation und Mehrwert ermöglichen.
Agentische KI eröffnet neue Perspektiven
Ein wachsender Anteil der Firmen setzt inzwischen auf sogenannte agentische KI – Systeme, die eigenständig Aufgaben übernehmen können. Sie werden vor allem als Chatbots oder integrierte Funktionen in bestehenden Tools eingesetzt.
Laut der Studie berichten mehr als die Hälfte der Nutzer, dass die Zusammenarbeit mit KI-Agenten neue Arbeits- und Lernweisen fördert. Beschäftigte gewinnen Freiräume, um sich auf komplexere Tätigkeiten zu konzentrieren. Dennoch nutzen bisher nur 42 Prozent der Unternehmen solche Lösungen, was auf ein noch frühes Reifestadium hindeutet.
KI verändert Wertschöpfung, aber nicht die Prozesse
KI beeinflusst laut Studie bereits viele Unternehmensbereiche – besonders in Operations und Supply Chain. Doch während technische Anpassungen vorangetrieben werden, bleiben organisatorische Veränderungen oft aus.
Zwar modernisieren 63 Prozent ihre Datenplattformen und 62 Prozent automatisieren Arbeitsabläufe, doch nur gut ein Drittel überprüft die zugrunde liegenden Prozesse oder Kennzahlen. Damit bleibt das Potenzial der Technologie häufig ungenutzt.
Theis betont, dass echter Fortschritt erst entsteht, wenn Organisationen ihre Prozesse neu denken und KI gezielt in diese Strukturen integrieren – statt sie lediglich darüberzulegen.
Schulung und Befähigung bleiben Baustellen
Die meisten Unternehmen stellen zwar die notwendigen Tools bereit, doch Schulung und Coaching hinken hinterher. Nur knapp die Hälfte bietet gezielte Lern- oder Mentoringprogramme an, und weniger als jeder Zweite schafft Freiräume zum Experimentieren.
Das spiegelt sich in der Nutzung wider: KI wird häufig als Suchhilfe oder Berichterstattungstool eingesetzt, seltener für komplexe, systemübergreifende Aufgaben.
Svirida warnt, dass technologische Einführung allein nicht ausreicht. Der kulturelle Wandel müsse mitwachsen – Mitarbeitende müssten befähigt und motiviert werden, KI aktiv zu nutzen und zu gestalten.
Für nachhaltigen KI-Erfolg sehen die Befragten vor allem drei Hebel: klare Führungsverantwortung, eine abgestimmte Strategie und eine solide Datenarchitektur.
Rund die Hälfte nennt außerdem eine offene Lernkultur und flexible Betriebsmodelle als entscheidend. Nur ein Drittel misst den Erfolg anhand klarer Kennzahlen oder Rendite.
Letztlich, so Theis, entstehe echter Nutzen erst durch das Zusammenspiel von Technologie, Daten und Menschen – „ein Dreiklang, ohne den KI kein strategischer Mehrwert werden kann“.