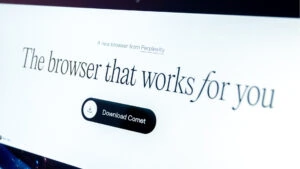Google will mit solar-betriebenen Satelliten die Energieprobleme seiner KI-Infrastruktur lösen. Erste Testmissionen sind bereits für 2027 geplant.
Der Tech-Konzern hat ein ambitioniertes Forschungsprojekt namens “Project Suncatcher” vorgestellt, das die ressourcenintensiven KI-Rechenzentren des Konzerns künftig ins All verlagern könnte. Die Idee: Tensor Processing Units (TPUs) auf Satelliten zu installieren, die mit Solarpanels ausgestattet sind und dort nahezu rund um die Uhr saubere Energie erzeugen können.
“In Zukunft könnte das Weltall der beste Ort sein, um KI-Rechenleistung zu skalieren”, schreibt Travis Beals, Senior Director for Paradigms of Intelligence bei Google, in einem Blogbeitrag. Das Unternehmen veröffentlichte zudem ein Preprint-Paper, das die bisherigen Fortschritte des Projekts dokumentiert, allerdings noch ohne wissenschaftliches Peer-Review.
Achtmal produktivere Solarenergie
Der Hintergrund des Projekts sind die massiven Energieprobleme erdgebundener KI-Rechenzentren. Diese treiben nicht nur die Stromkosten in die Höhe, sondern auch die Emissionen von Kraftwerken. Im Orbit könnten Solarpanels laut Google etwa achtmal produktiver arbeiten als vergleichbare Anlagen auf der Erde, da sie praktisch kontinuierlich Strom erzeugen können.
Allerdings gibt es erhebliche technische Hürden zu überwinden. Eine zentrale Herausforderung ist die Kommunikation zwischen den Satelliten. Um mit erdbasierten Rechenzentren konkurrieren zu können, seien Verbindungen mit “Dutzenden Terabit pro Sekunde” nötig, so Google. Dies erfordere extrem enge Satellitenformationen mit Abständen von “Kilometer oder weniger”. Das ist deutlich geringer als bei heutigen Satelliten und erhöht das Risiko von Kollisionen mit Weltraumschrott.
Strahlenschutz und Kostenrechnung
Ein weiteres Problem ist die erhöhte Strahlenbelastung im All. Google testete seine Trillium-TPUs auf Strahlungstoleranz und gibt an, dass diese “einer Gesamtstrahlendosis standhalten, die einer fünfjährigen Mission entspricht, ohne permanente Ausfälle”.
Derzeit wären die Startkosten für solche Weltraum-Rechenzentren noch prohibitiv hoch. Googles Kostenanalyse kommt jedoch zu dem Schluss, dass der Betrieb im All bis Mitte der 2030er Jahre “etwa vergleichbar” mit den Energiekosten eines entsprechenden Rechenzentrums auf der Erde sein könnte, gerechnet auf Basis von Kilowatt pro Jahr.
Für 2027 plant Google zusammen mit dem Unternehmen Planet eine gemeinsame Mission, um erste Prototypen-Satelliten zu starten und die Hardware im Orbit zu testen.
Bezos sieht ähnlichen Trend
Google steht mit dieser Vision nicht allein da. Bereits im Oktober äußerte sich Amazon-Gründer Jeff Bezos auf der Italian Tech Week in Turin ähnlich optimistisch: Er rechnet damit, dass Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre kostengünstiger im Orbit betrieben werden können als auf der Erde. Sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin entwickelt mit “Blue Ring” bereits eine Plattform für orbitale Logistik, die strahlungsgehärtete Hardware für Cloud-Dienste im All transportieren soll.
Auch andere Unternehmen wie Axiom Space, Starcloud, NTT und Ramon.Space arbeiten an entsprechenden Projekten. Das Startup Lonestar installierte Anfang 2024 bereits ein Proof-of-Concept-Rechenzentrum auf dem Mond. Ob aus den ambitionierten Plänen tatsächlich Realität wird, dürfte sich in den kommenden Jahren zeigen.