Zwölf Stunden Arbeit am Tag, sechs Tage die Woche: Das sogenannte 996-Arbeitsmodell war einst Symbol für Chinas Tech-Aufstieg. Heute ist es dort verboten. Während Peking auf Entschleunigung setzt, entdeckt ausgerechnet das Silicon Valley die Idee neu. Junge US-Start-ups feiern extreme Arbeitszeiten als Ausdruck von Leistungsbereitschaft. Und auch in Deutschland könnte eine geplante Arbeitszeitreform den Boden für ähnliche Entwicklungen bereiten.
Der Preis des Fortschritts
Arbeiten von 9 bis 21 Uhr, sechs Tage pro Woche war die inoffizielle Regel in Chinas Boomjahren der 2010er. Unternehmen wie Alibaba, Bytedance und Huawei profitierten enorm von diesem Modell, das Effizienz und Opferbereitschaft verherrlichte. Doch der Preis war hoch: Übermüdung, Burn-outs und Todesfälle durch Überarbeitung.
2019 schlug die Stimmung um. Auf der Plattform Github entstand die Anti-996-Bewegung, ein digitaler Aufstand gegen endlose Arbeitstage. Zehntausende Entwickler dokumentierten Verstöße, teilten Erfahrungsberichte und forderten ein Ende der Selbstausbeutung. Zwei Jahre später erklärte Chinas Oberstes Volksgericht das Modell offiziell für rechtswidrig. Das Arbeitsrecht sieht eine maximale Wochenarbeitszeit von 44 Stunden vor, Überstunden müssen bezahlt werden.
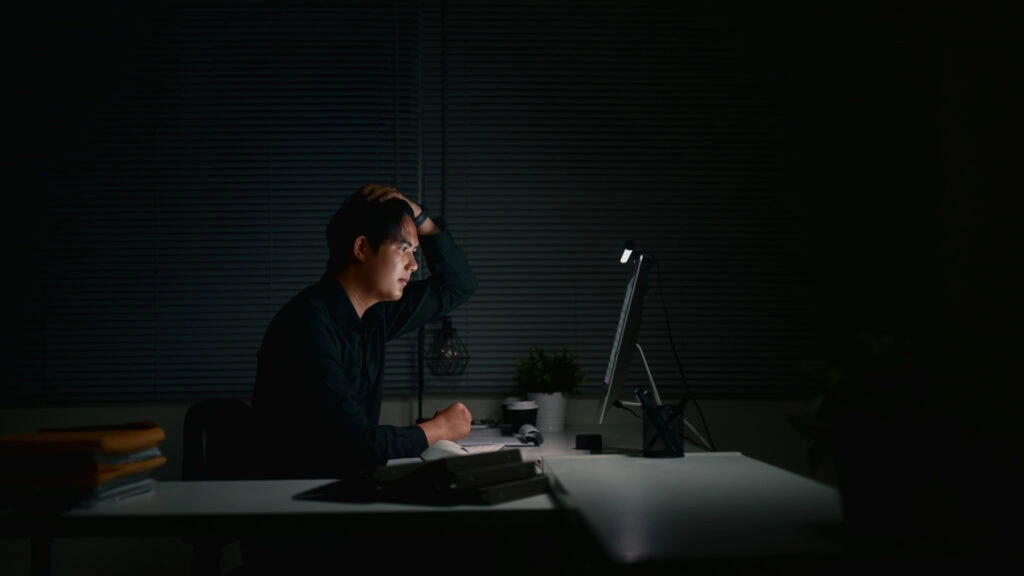
In der Praxis bleibt das Verbot jedoch oft wirkungslos. Viele Unternehmen verlangen weiterhin 60-Stunden-Wochen, meist ohne Ausgleich. Ein britischer Angestellter, der in Guangzhou arbeitete, beschrieb die Situation gegenüber International Business Times als unerträglich. Selbst sonntags seien die Büros voll gewesen.
Silicon Valley entdeckt den Dauerstress
Vier Jahre nach dem chinesischen Verbot erlebt das 996-Modell ein unerwartetes Revival in den USA. Start-ups in Kalifornien und New York bekennen sich offen zu 70- bis 80-Stunden-Wochen. „Keine Work-Life-Balance, nur Work“ lautet das neue Credo vieler Gründerinnen und Gründer.
Das KI-Unternehmen Cognition erwartet von neuen Mitarbeitenden 80 Stunden pro Woche. CEO Scott Wu nennt das einen Beweis für Hingabe. Auch Rilla AI schreibt Entwicklerstellen mit rund 70 Wochenstunden aus, bei Gehältern von bis zu 300.000 Dollar im Jahr. Das Start-up Icon verlangt laut eigener Website Reaktionszeiten in Minuten oder Sekunden, auch nachts und an Wochenenden.
Historikerin Margaret O’Mara erklärt den Trend mit der Angst vor Jobverlust. Seit 2022 hat die US-Techbranche über 400.000 Stellen gestrichen. Viele Beschäftigte arbeiteten deshalb länger, um unverzichtbar zu bleiben. Schon früher hatten Manager wie Sergey Brin 60-Stunden-Wochen als „Sweet Spot der Produktivität“ bezeichnet.
Ex-Google-CEO Eric Schmidt sagte kürzlich in einem Podcast, die USA müssten „gegen China konkurrieren, das faktisch im 996-Modus arbeitet“, auch wenn das Modell dort verboten ist. Daten der Finanzplattform Ramp zeigen, dass immer mehr Angestellte im Silicon Valley auch samstags Firmenkreditkarten für Mahlzeiten oder Einkäufe nutzen. Das Wochenende wird stillschweigend abgeschafft.

Deutschland: Reform mit Nebenwirkungen
In Deutschland wäre das 996-Modell derzeit eindeutig rechtswidrig. Die geplante Arbeitszeitreform der Merz-Regierung könnte jedoch indirekt längere Arbeitstage ermöglichen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, die tägliche Höchstarbeitszeit durch eine wöchentliche Grenze von 48 Stunden zu ersetzen. Damit wären künftig Arbeitstage von mehr als zwölf Stunden möglich, eine klare Abkehr vom Achtstundentag.
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nennt die Reform „zeitgemäß für das digitale Zeitalter“. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbund Yasmin Fahimi warnt hingegen, sie öffne „rechtlich fragwürdigen Geschäftsmodellen“ Tür und Tor.
Schon heute zeigt sich, dass viele Beschäftigte weit über die Grenzen hinaus arbeiten. Laut Studien leisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland jährlich rund 638 Millionen unbezahlte Überstunden. Zugleich wünschen sich drei Viertel von ihnen klare Grenzen und maximal acht Stunden pro Tag.
Unterschiede bei den Arbeitsmodellen in Europa
Europa befindet sich aktuell in einem bemerkenswerten Widerspruch: Während mehrere Länder eine Verkürzung der Arbeitszeit vorantreiben und verstärkt auf Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben Wert legen, etabliert sich insbesondere in der Tech- und Finanzbranche eine Gegenbewegung. Diese erinnert stark an die intensive „Grind Culture” des Silicon Valley. Beide Tendenzen existieren nebeneinander – befeuert durch ökonomischen Druck, den Mangel an qualifizierten Fachkräften sowie die geopolitische Konkurrenzsituation.
So gehen beispielsweise im Süden Europas die Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen. Spanien hat 2025 eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 37,5 Wochenstunden bei unverändertem Gehalt beschlossen. Die Maßnahme soll Erschöpfung vorbeugen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit erhöhen. Bereits seit 2023 testet das Land staatlich geförderte Vier-Tage-Wochen-Projekte. Italien dagegen bleibt bei der 40-Stunden-Woche, setzt jedoch verstärkt auf flexible Arbeitsmodelle und saisonale Anpassungen, etwa um der Sommerhitze Rechnung zu tragen.
Die skandinavischen Länder gelten mit ihren ausgewogenen Arbeitsmodellen als Vorreiter. Dänemark und Finnland erproben seit Jahren Vier-Tage-Wochen oder Sechs-Stunden-Arbeitstage mit messbaren Erfolgen: Die Produktivität steigt, die psychische Belastung sinkt. Laut dem European Life-Work Balance Index 2025 zählt Belgien gemeinsam mit Irland und Island zu den Ländern mit der besten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Gemeinsam ist diesen Staaten der Fokus auf digitale Strukturen, Eigenverantwortung und gegenseitiges Vertrauen. Lange Anwesenheitszeiten verlieren dadurch an Bedeutung. Entscheidend ist hier das Ergebnis, nicht die Präsenz im Büro.

Gleichzeitig entsteht in Europas Tech-Szene eine Gegenbewegung, die stark von angelsächsischen Vorbildern geprägt ist. Seit Mitte 2025 fordern mehrere einflussreiche Risikokapitalgeber wie Harry Stebbings von 20VC und Martin Mignot von Index Ventures öffentlich längere Arbeitswochen für Start-up-Gründer. Nur so könne Europa im globalen Wettbewerb mit den USA und China mithalten. Trotz Kritik der Öffentlichkeit an dieser Mentalität zeigt sich eine schleichende Veränderung: In Städten wie London und Berlin werden Arbeitswochen nahe der 60-Stunden-Marke zunehmend akzeptiert, besonders in Start-ups mit Venture-Capital-Beteiligung und internationalem Konkurrenzdruck.
Den rechtlichen Rahmen bildet nach wie vor die EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG. Diese legt eine maximale durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden fest, Überstunden eingeschlossen. Während die Richtlinie klare Obergrenzen definiert, räumt sie den Mitgliedstaaten erheblichen Spielraum bei der konkreten Umsetzung ein. Die in Deutschland geplanten Reformen werden europaweit aufmerksam verfolgt und könnten als Präzedenzfall für weitere Entwicklungen dienen.
Zwischen Produktivität und Selbstschutz
Dass ein in China verbotenes Arbeitsmodell nun in den Innovationszentren des Westens gefeiert wird, ist eine Ironie der Globalisierung. 996 steht für eine Welt, in der Arbeit mehr ist als Broterwerb: Sie wird zur Identität, zum Leistungsversprechen und zum Risiko.
Die entscheidende Frage lautet, wie weit moderne Gesellschaften bereit sind zu gehen, um produktiv zu bleiben. Und wer am Ende die Grenze zieht zwischen Motivation und Selbstausbeutung.
In China wurde diese Grenze juristisch festgelegt. Im Silicon Valley wird sie moralisch verschoben. Deutschland steht noch dazwischen.
Quelle: Dieser Artikel basiert in abgewandelter Form auf einem Beitrag von karrierewelt.golem.de
















