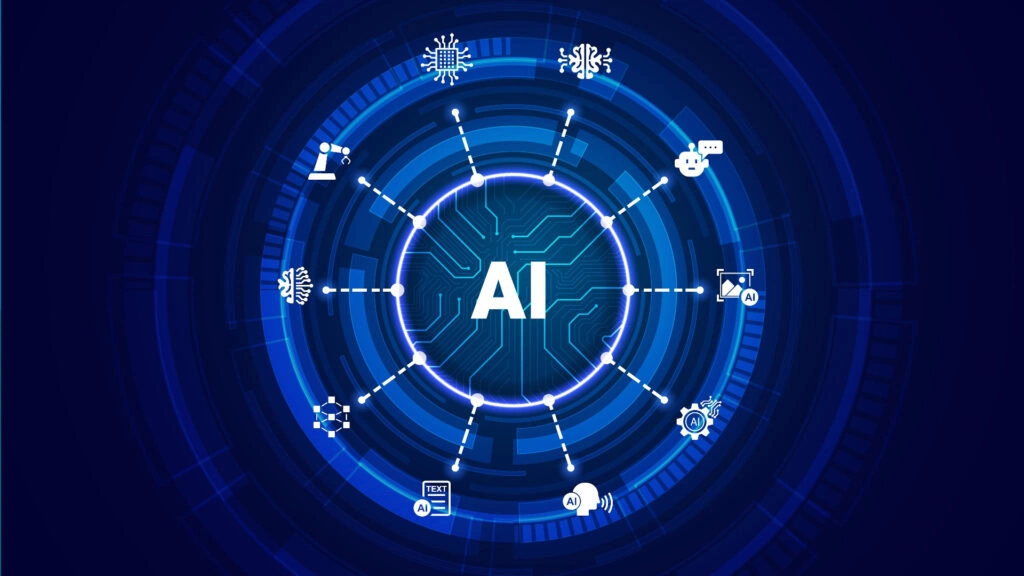Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt – doch ihre Leistungsfähigkeit hängt entscheidend von den Daten ab, mit denen sie trainiert wird. Ob generative Sprachmodelle, Bilderkennung oder industrielle Automatisierung: KI-Systeme benötigen enorme Mengen an aktuellen, vielfältigen und qualitativ hochwertigen Daten.
Diese Daten stammen zunehmend nicht nur aus internen Unternehmensquellen, sondern auch aus externen Quellen. Proprietäre externe Daten liefern mehr Kontext und können zum Fine-Tuning und Retrieval-Augmented Generation (RAG) genutzt werden. Ohnehin bauen alle Foundational Models auf externen, größtenteils öffentlich zugänglichen Daten auf. Hierzu zählen z.B. GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google DeepMind), Claude (Anthropic), LLaMA (Meta) und mit Mistral AI (Mistral) auch ein bedeutender europäischer Akteur.
Um diese Daten effektiv nutzen zu können, benötigen Unternehmen und Institutionen eine Infrastruktur für den strukturierten, sicheren und rechtskonformen Austausch – zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen. Diese Plattformen verbinden Datenanbieter und -käufer und ermöglichen den Zugang zu wertvollen Daten. Damit fungieren Datenmarktplätze als Katalysatoren für Innovation und sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer modernen, datengetriebenen Wirtschaft.
Europas Chance: Souveräne Dateninfrastruktur statt Abhängigkeit
Die größten Datenmarktplätze der Welt – von Snowflake Marketplace über Databricks Marketplace bis zum AWS Data Exchange – stammen aus den USA. Sie dominieren den Markt und prägen dabei nicht nur die Technologie, sondern auch die Standards. Doch mit Blick auf Datenschutz, Datenhoheit und unternehmerische Abhängigkeiten stellt sich die Frage: Ist das zukunftsfähig für Europa?
Die Antwort lautet: Nein – zumindest nicht ausschließlich. Denn während amerikanische Plattformen oft außerhalb europäischer Regulierungsrahmen agieren, setzen unabhängige europäische Anbieter längst eigene Standards – datenschutzkonform, transparent und technologisch auf Augenhöhe:
- DataHub Europe (München): Eine Initiative von Schwarz Digits, Deutscher Bahn und anderen, um eine zentrale, europäische Dateninfrastruktur für Industrie und Medienlandschaft zu schaffen.
- Datarade (Berlin): Ein globaler Datenmarktplatz, der die Suche nach Datenanbietern vereinfacht und auf Privacy-by-Design Prinzipien setzt – ohne Speicherung von Daten auf der Plattform selbst.
- Taktile (Berlin): Eine Risk-Management-Plattform, die auch einen integrierten Datenmarktplatz für Firmendaten betreibt.
- UP42 (Berlin): Eine Satellitendaten-Plattform, mit einem integrierten Marktplatz, der Zugang zu führenden Anbietern von Satellitendaten bietet.
- DAWEX (Paris): Bietet Technologien für den sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen und ist Vorreiter im Bereich Data Governance.
- Opendatasoft (Paris): Unterstützt Verwaltungen bei der Umsetzung von Open-Data-Portalen.
- Harbr Data (London): Ermöglicht Firmen, eigene interne Datenmarktplätze und White-Label-Lösungen aufzubauen.
Hinzu kommen zahlreiche spezialisierte Datenmarktplätze: zum Beispiel für Mobilitätsdaten, Umweltdaten oder industrielle Sensordaten. Gerade diese branchenspezifischen Plattformen bieten echten Mehrwert – etwa für Predictive Maintenance, CO₂-Tracking oder Verkehrsflussoptimierung. In Kombination mit semantischen Beschreibungen und standardisierten Metadaten ermöglichen sie nicht nur den Zugang zu Daten, sondern auch deren schnelle Integration in KI-gestützte Anwendungen.
Nicht zu vergessen: Initiativen wie GAIA-X und Catena-X, die daran arbeiten, föderierte, interoperable Datenökosysteme zu schaffen – in denen Marktplätze eine zentrale Rolle spielen. Sie zeigen, dass es möglich ist, europäische Werte wie Transparenz, Fairness und Datensouveränität mit wirtschaftlicher Skalierbarkeit zu verbinden.
Es bedarf jedoch einer stärkeren politischen Unterstützung, um diese Akteure gezielt zu fördern und ihre Position im Wettbewerb mit internationalen Giganten zu stärken – nicht durch Abschottung, sondern durch die Schaffung fairer und ausgewogener Rahmenbedingungen.
Vertrauen durch Rechtsrahmen – Datenaustausch braucht klare Spielregeln
Eine der Kernaufgaben von Marktplätzen ist die Schaffung von Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern – und das gilt umso mehr für Datenmarktplätze. Sie müssen auf geschäftlicher, technischer, und regulatorischer Ebene Vertrauen schaffen:
- Datensicherheit durch Verschlüsselung und kontrollierte Zugriffskonzepte,
- Datenschutz durch Einhaltung der DSGVO und anonymisierte Datenmodelle,
- Schutz von geistigem Eigentum durch Angabe zu Datenquellen,
- Verwertungsrechte, die klar regeln, wie Daten genutzt werden dürfen,
- sowie KYC-Verfahren zur Identitätsprüfung von Anbietern und Käufern.
Die rechtlichen Grundlagen hierfür existieren bereits in Teilen – etwa durch den EU Data Governance Act. Er verpflichtet sogenannte „Datenvermittlungsdienste“ zur Registrierung, gibt erste Standards vor und stärkt die Rolle von unabhängigen Intermediären. Auch der kommende EU Data Act schafft zusätzliche Transparenz – vor allem bei industriell erzeugten Daten, etwa durch Maschinen, Fahrzeuge oder Sensoren. In Bezug auf personenbezogene Daten setzten die EU GDPR und DSGVO schon sehr klare Regeln- die natürlich auch für den Austausch von Daten gelten.
Doch das kann nur der Anfang sein. Insbesondere für den Austausch von personenbezogenen Daten sind klare regulatorische Mechanismen notwendig. Hier könnte z.B. ein Register nach amerikanischem Vorbild mehr Transparenz schaffen: Ein zentrales, europaweites “EU Data Broker Registry”. Dieses Register könnte Missbrauch verhindern und die Nachvollziehbarkeit von Datenflüssen gewährleisten. Wer personenbezogene Daten verkauft, müsste offenlegen, woher diese stammen, wofür sie verwendet werden und welche Weitergaben geplant sind. Das stärkt nicht nur den Verbraucherschutz, sondern auch die Rechtssicherheit für Unternehmen.
Denn in einem Umfeld ohne verbindliche Standards gewinnen oft die Lautesten – nicht die Seriösesten. Wer aber mit sauberen, datenschutzkonformen Geschäftsmodellen arbeitet, sollte auch davon profitieren: durch Vertrauen am Markt, durch geringeres rechtliches Risiko und durch eine starke Position im Wettbewerb.
Fazit: Datenmarktplätze als Schlüssel zur datengetriebenen Zukunft mit KI
Datenmarktplätze sind ein Schlüssel zur digitalen Transformation, da sie den Zugang zu den Daten ermöglichen, die für KI und fortschrittliche Technologien unerlässlich sind. Sie müssen jedoch als zentrale Infrastruktur für den sicheren, transparenten und skalierbaren Austausch von Daten etabliert werden. Ein klarer rechtlicher Rahmen ist notwendig, um Datenschutz, Datensouveränität und die Qualität des Marktes zu gewährleisten.
Eine faire und klare Regulierung ist entscheidend, damit Datenmarktplätze nicht nur als technische Infrastruktur, sondern auch als vertrauenswürdige Akteure in der digitalen Wirtschaft fungieren können. Europa könnte hier einen Wettbewerbsvorteil erzielen, indem es Plattformen fördert, die sowohl technologisch fortschrittlich als auch datenschutzkonform sind.
Um eine führende Rolle in der digitalen Zukunft zu übernehmen, sollte Europa gezielt in den Ausbau europäischer Datenmarktplätze investieren und klare regulatorische Leitlinien setzen. So könnten diese als vertrauenswürdige, transparente Akteure auf der globalen Bühne agieren.