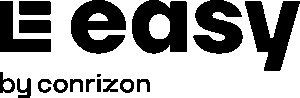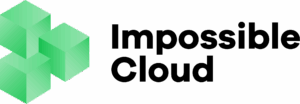Während KI und beschleunigtes Computing die Datenstrategien von Unternehmen grundlegend verändern, positionieren sich immer mehr Storage-Anbieter mit Architekturen, die sie als „Parallel File Systems“ bezeichnen.
Leider wird dieser Begriff häufig uneinheitlich verwendet, was für Architekten erhebliche Herausforderungen schafft, wenn sie zwischen Scale-out-NAS, verteilten Object Stores sowie tatsächlichen, echten Parallel-Dateisystemen unterscheiden müssen.
Der Begriff „Parallel File System“ entstand in der HPC-Community, zu einer Zeit als parallele Prozessoren massiv die Grenzen von Single-Server Storage offenbarten. Das Konzept entwickelte sich parallel zu MPP- und Hypercube-Architekturen Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre. Forscher suchten damals nach Storage-Architekturen, die mit paralleler Rechenleistung skalieren konnten. Intels Concurrent File System (CFS) demonstrierte bereits entkoppelte Storage-Knoten und gleichzeitigen Zugriff über mehrere I/O-Nodes hinweg, während spätere Forschungssysteme wie IBMs Vesta Storage explizit als parallelen Service und nicht als zentralen Engpass betrachteten. Diese Systeme etablierten ein Grundprinzip, das bis heute gilt: Wenn die Berechnung parallel ist, muss auch der Storage-Zugriff parallel erfolgen.
Was ist ein paralleles Dateisystem?
Über HPC, KI und großskalige Analytik hinweg besteht ein gemeinsames Verständnis dessen, was ein Parallel File System (PFS) ausmacht. Im Kern ist ein PFS eine verteilte Storage-Architektur, in der viele Clients Daten direkt und parallel über mehrere Storage-Knoten hinweg innerhalb eines gemeinsamen Namespace auf Basis von out-of-band bereitgestellten Metadaten zugreifen.
Die Anforderung der direkten Client-zu-Storage Kommunikation ist in diesem Zusammenhang fundamental. In einem echten parallelen Dateisystem kommunizieren Clients nicht über Front-End-Controller, NAS-Heads oder Proxy-Gateways. Stattdessen bauen sie parallele Datenpfade zu vielen Storage-Knoten gleichzeitig auf. Genau das ermöglicht eine lineare und vorhersehbare Skalierung der Performance, wenn zusätzliche Compute- oder Storage-Knoten hinzugefügt werden.
Dieses Prinzip beschränkt sich nicht auf klassische HPC-Systeme, sondern findet sich auch in modernen, standardbasierten Designs wie Parallel NFS (pNFS), einschließlich pNFSv4.2, das in allen gängigen Linux-Distributionen enthalten ist. Bei pNFSv4.2 erhalten Clients beispielsweise Layout-Informationen von einem Metadaten-Server und kommunizieren anschließend direkt mit den entsprechenden Storage-Knoten. Der Metadaten-Server koordiniert Layout-Status und Zugriffsrechte, fungiert jedoch niemals als Datenproxy – ein zentrales Merkmal echter Parallelität.
Metadaten außerhalb des Datenpfads: Das grundlegende Prinzip
Die Trennung von Metadaten und Datenpfad ist vielleicht das wichtigste Merkmal eines parallelen Dateisystems. In einem echten PFS sind Metadaten architektonisch so gestaltet, dass sie keinen serialisierten Engpass darstellen. Stattdessen werden Metadaten-Operationen über mehrere Knoten verteilt, an Clients delegiert und durch intelligentes Caching oder parallele Orchestrierung umgesetzt.
.Diese Unterscheidung mag akademisch klingen, hat jedoch tiefgreifende Auswirkungen auf die Performance. In Architekturen, in denen Metadaten- und Datentraffic vermischt sind oder Metadaten-Operationen über Controller-Knoten laufen, ist die Nebenläufigkeit grundlegend eingeschränkt. Moderne PFS-Designs hingegen erlauben es, dass Metadaten unabhängig vom Datenstrom fließen, sodass das System horizontal skalieren kann, ohne dabei Performance einzubüßen. Protokolle wie pNFS verstärken dieses Modell, indem sie Layouts out-of-band bereitstellen, während der Datenfluss vollständig über verteilte, parallele Pfade erfolgt.
Verteiltes Datenlayout und echte Parallelität
Parallele Dateisysteme verteilen Daten über viele Storage-Knoten hinweg so, dass Clients unterschiedliche Teile von Dateien parallel lesen und schreiben können. Ganz gleich, ob dies durch explizites Striping, ausgehandelte Layouts oder aber clientgesteuerte Platzierung erfolgt, das Ergebnis ist identisch: ein System, das für Multi-Node- und Multi-Stream-I/O im großen Maßstab optimiert ist.
Entscheidend ist, dass diese Parallelität aus direktem Zugriff auf mehrere Knoten entsteht und nicht aus der Aggregation von Performance hinter Front-End Controllern, wie es bei Scale-out-NAS Architekturen üblich ist. In einem parallelen Dateisystem ist Skalierbarkeit eine inhärente Eigenschaft des Datenpfades selbst. Das Hinzufügen weiterer Controller zu einem NAS-System kann zwar Kapazität oder Durchsatz bis zu einem gewissen Punkt erhöhen, beseitigt jedoch nicht die architektonischen Einschränkungen von controllervermitteltem I/O.
Echte Skalierbarkeit entsteht durch Clients und Storage-Knoten, nicht durch Controller
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal echter PFS-Architekturen besteht darin, dass die Performance direkt mit der Anzahl der Clients und Storage-Knoten skaliert. Werden zusätzliche GPU-Server und/oder Storage-Knoten hinzugefügt, steigen aggregierter Durchsatz und Nebenläufigkeit auf natürliche Weise.
Architekturen, die I/O über Controller leiten, können diese Art der Skalierung nicht bieten. Unabhängig davon, wie viele Backend-Storage Geräte schlussendlich verwaltet werden, bleiben die Front-End Controller feste Engpässe. In hochgradig parallelen Umgebungen, wie sie moderne KI-Pipelines erfordern, wird diese Einschränkung sehr schnell offensichtlich.
Metadaten-Architektur ist weit wichtiger, als viele Diskussionen vermuten lassen
Die Metadaten-Architektur wird häufig auf vereinfachende Begriffe wie etwa „zentralisiert“ oder „verteilt“ reduziert. Für effektive KI- und HPC-Performance ist jedoch deutlich mehr Differenzierung erforderlich. In großen Umgebungen müssen Metadaten hohe Nebenläufigkeit unterstützen, Namespace-Operationen parallel bedienen sowie Delegation oder clientseitiges Metadaten-Caching ermöglichen. Für moderne KI-Workloads müssen sie zudem Lokalität über mehrere Standorte und Clouds hinweg bewahren und Metadaten aus externen Storage-Systemen in einen einheitlichen globalen Kontext integrieren.
Diese Fähigkeiten sind entscheidend, da KI-Workloads zunehmend Datensätze umfassen, die über Silos, Protokolle und geografische Regionen verteilt sind. Metadaten müssen global skalieren können, ohne in den Datenpfad einzutreten: ein klarer Vorteil echter paralleler Dateisystem-Architekturen.
Ein globaler Namespace macht ein System noch nicht parallel
Viele Storage-Systeme bewerben heute einen „globalen Namespace“. Dieses Merkmal allein macht ein System jedoch nicht automatisch zu einem parallelen Dateisystem. Ein globaler Namespace bietet einheitliche Sichtbarkeit und Zugriffsmöglichkeiten, garantiert aber keinen parallelen I/O.
Ein paralleles Dateisystem erfordert sowohl einen gemeinsamen Namespace als auch die architektonische Fähigkeit, dass Clients Daten direkt und gleichzeitig über mehrere Storage-Knoten hinweg abrufen können, wobei Metadaten vollständig vom Datenpfad getrennt sind. Einige parallele Dateisysteme bieten diese Fähigkeiten nur innerhalb ihrer eigenen Storage-Domänen, während standardbasierte Ansätze wie pNFS den Metadaten-Layer nutzen, um den Zugriff über heterogene, NFS-basierte Storage-Systeme hinweg zu vereinheitlichen. Diese Unterschiede haben einen erheblichen Einfluss darauf, wie nützlich ein globaler Namespace für KI-Workloads im großen Maßstab wirklich ist.
Multiprotokoll-Unterstützung ist notwendig, aber nicht ausreichend
KI-Workflows erfordern heute häufig sowohl POSIX- als auch S3-Zugriff. Viele Systeme geben an, Datei- und Objektprotokolle zu unterstützen, doch das zugrunde liegende Architekturmodell ist entscheidend. In einigen Designs wird S3-Zugriff über Gateway- oder Controller-Schichten realisiert, wodurch Object-Traffic durch dieselben Engpass-Pfade gezwungen wird wie File-I/O. In anderen Architekturen sind Objekt-Semantiken direkt in die verteilte, parallele Architektur integriert, sodass auch Objektzugriffe horizontal skalieren und denselben Direct-to-Storage Datenpfaden folgen wie Dateizugriffe. Daher reicht es nicht aus, Datei- und Objektprotokolle zu unterstützen, wenn eines davon über zentrale Frontends geleitet wird.
Moderne parallele Dateisysteme haben sich weit über Legacy-Designs hinaus entwickelt
Es ist irreführend, moderne parallele Dateisysteme mit Implementierungen aus den frühen 2000er-Jahren zu vergleichen. Zeitgemäße Designs integrieren verteilte Metadaten-Services, dynamische Layout-Aushandlung, skalierbare und verteilte Locking-Mechanismen, clientseitige Delegation, parallele Namespace-Operationen sowie globale Datenwahrnehmung über mehrere Standorte und Storage-Typen hinweg.
Diese Fähigkeiten spiegeln den Wandel hin zu KI-interaktiven und heterogenen Computing-Umgebungen wider, ganz im Gegensatz zu den Batch-orientierten Workloads, die frühe HPC-Systeme geprägt haben. Der Stand der Technik hat sich erheblich weiterentwickelt.
Controller-Engpässe: die klarste Trennlinie zwischen NAS und PFS
Eine der einfachsten Methoden, Scale-out-NAS von einem parallelen Dateisystem zu unterscheiden, ist die Betrachtung des I/O-Pfads der Clients. Müssen Clients Daten oder Metadaten (unabhängig von der Anzahl der Controller) über Controller-Knoten leiten, wird die Architektur zwangsläufig eine Performance-Obergrenze erreichen, die durch CPU- und Netzwerkkapazität der Controller bestimmt ist.
Diese Einschränkung ist besonders problematisch in KI-Umgebungen, in denen Tausende von GPUs einen erheblichen East-West Traffic erzeugen, Inferenz-Workloads extrem niedrige Latenzen erfordern sowie Metadaten-Operationen parallel bedient werden müssen. Parallele Dateisysteme umgehen diese Grenzen, indem sie Controller aus dem Datenpfad entfernen und direkten, gleichzeitigen Client-Zugriff auf Storage-Knoten ohne Intermediäre ermöglichen.
Rebuild- und Haltbarkeitsfunktionen bieten keinen Differenzierungsvorteil mehr
Viele moderne verteilte Systeme unterstützen fortschrittliches Erasure Coding, parallele Rebuilds sowie flexible Fault-Domain Konfigurationen. Diese Funktionen sind wichtig, aber inzwischen weit verbreitet in Object Stores, Scale-out-NAS und parallelen Dateisystemen. Sie stellen keinen Indikator dar für architektonische Parallelität, sondern spiegeln lediglich den aktuellen Stand von verteilter Storage-Technologie wider.
KI-Workloads gehen weit über Training hinaus (und belasten Storage anders)
Ein Großteil der Diskussionen in der Brache konzentriert sich weiterhin auf Trainings-Benchmarks. Die reale KI-Performance in Unternehmen hängt jedoch zunehmend von Inferenz, Microservices, agentischem KI-Verhalten sowie multimodalen Modellen ab, die schnellen Zugriff auf unterschiedlichste, oft weit verteilte Datentypen benötigen. Diese Workloads zeichnen sich durch hohe Fan-out Muster, extreme Nebenläufigkeit und starke Latenz-Sensitivität aus.
Architekturen, die auf Controller-Knoten oder serialisierte Metadate-Operationen angewiesen sind, geraten unter diesen Bedingungen schnell an ihre Grenzen. Echte parallele Dateisysteme sind für solche Workloads prädestiniert, da sie direkte Zugriffspfade, verteiltes Metadatenmanagement und hohe Nebenläufigkeit ohne zentrale Engpässe bieten.
Was moderne KI-Datenplattformen tatsächlich benötigen
In der Praxis teilen Storage-Systeme, die KI im großen Maßstab unterstützen sollen, eine Reihe gemeinsamer architektonischer Prinzipien. Sie ermöglichen direkte, parallele I/O zwischen Clients und Storage-Knoten, sodass Bandbreite und Nebenläufigkeit mit der Clustergröße skalieren. Sie trennen Metadaten vom Datenpfad und verteilen sie so, dass hohe Parallelität unterstützt wird.
Gleichzeitig bieten solche Systeme einheitliche Semantik für Datei- und Objektzugriff, ohne Gateways in kritische I/O-Pfade einzufügen, sodass mehrere Zugriffsmodelle dieselbe skalierbare Datenebene nutzen können. Sie erstrecken sich über heterogene Storage-Systeme, Clouds und Standorte hinweg, indem sie Metadaten vereinheitlichen, anstatt sie auf eine einzelne physische oder herstellerspezifische Umgebung zu beschränken. Zudem berücksichtigen sie Lokalität innerhalb von GPU-Clustern, sodass der Datenzugriff eng an die Compute-Fabric gekoppelt ist.
Schließlich bevorzugen moderne parallele Architekturen offene, standardbasierte Client-Zugriffe gegenüber proprietären Client-Layern, um breite Kompatibilität und langfristige Flexibilität im großen Maßstab zu gewährleisten.
Zusammengenommen definieren diese architektonischen Eigenschaften sowohl moderne parallele Dateisysteme als auch die Storage-Grundlagen, die erforderlich sind, um Data-Pipelines der Künstlichen Intelligenz effektiv zu unterstützen.
Warum echte Parallelität heute wichtiger ist denn je
Ein paralleles Dateisystem ist nicht einfach nur „schnell“ oder „scale-out“. Es handelt sich hier um eine Architektur, die durch verteilte Metadaten, direkten und gleichzeitigen Client-Zugriff auf Storage-Knoten sowie die Eliminierung von Controller-Engpässen aus dem Datenpfad definiert wird.
Moderne Implementierungen, einschließlich solcher auf Basis offener Standards wie pNFS, zeigen, wie diese Prinzipien skalierbare Abläufe über heterogene, standortübergreifende und Multi-Cloud Umgebungen hinweg ermöglichen.
Da KI-Infrastrukturen weiter wachsen, sollten Organisationen Technologien anhand dieser architektonischen Grundlagen bewerten und nicht anhand von Labels oder Begriffen aus dem Marketing. Nur Systeme, die auf echter Parallelität basieren, sind schlussendlich in der Lage, die Anforderungen der nächsten Generation von KI-Workloads (Nebenläufigkeit, Durchsatz, Latenz) zu erfüllen.