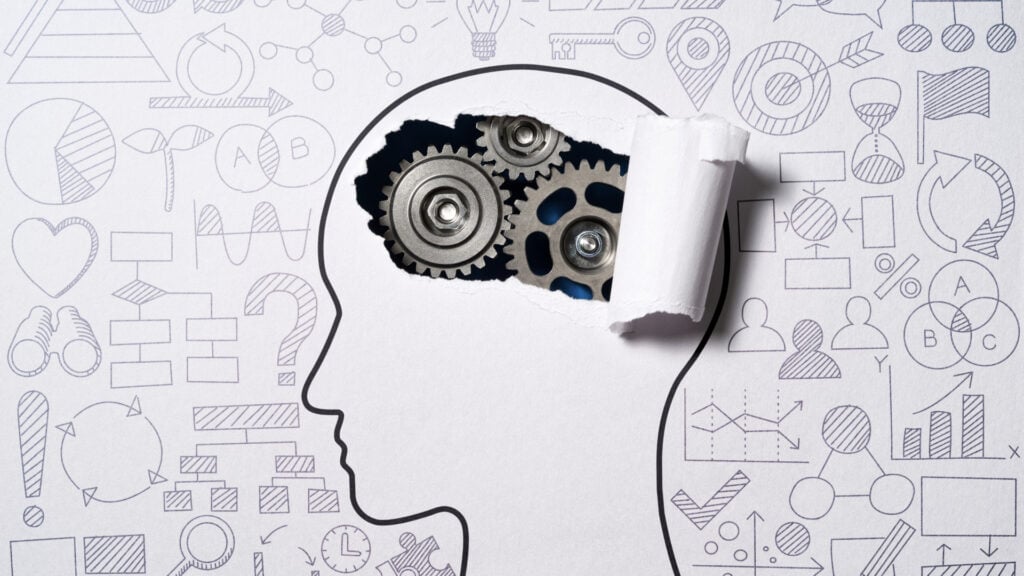Eine internationale Untersuchung von PwC zeigt, wie Beschäftigte weltweit und in Deutschland auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz blicken.
Für die Erhebung wurden fast fünfzigtausend Mitarbeitende befragt. Die Ergebnisse verdeutlichen eine wachsende Offenheit gegenüber KI, aber auch erhebliche Unterschiede zwischen Interesse und tatsächlicher Nutzung.
Viele Beschäftigte in Deutschland stehen neuen Technologien offen gegenüber. Fast die Hälfte ist gespannt darauf, wie KI den Arbeitsalltag verändern wird, und mehr als ein Viertel empfindet sogar echte Vorfreude. Dennoch bleibt die Anwendung hinter diesen Erwartungen zurück. Weniger als die Hälfte der Befragten hat im vergangenen Jahr überhaupt mit KI gearbeitet. Besonders niedrig ist der Anteil jener, die generative KI regelmäßig nutzen. Nur ein kleiner Teil setzt entsprechende Werkzeuge täglich oder wöchentlich ein.
Die Gründe für diese Zurückhaltung liegen laut PwC nicht in fehlender Technik. Stattdessen fehlen Know-how, klare Einsatzszenarien und Unterstützung durch Führungskräfte. Wer jedoch bereits mit generativen KI-Tools arbeitet, berichtet von deutlichen Vorteilen wie höherer Produktivität und mehr Kreativität.
Technologischer Wandel prägt die Arbeitswelt
Die Studie zeigt, dass die Einführung von KI Teil umfassender Veränderungen ist. Viele Beschäftigte nehmen technologische Entwicklungen, neue Kundenanforderungen und stärkere Regulierung als wichtigste Treiber wahr. Nur ein geringerer Anteil sieht den Klimawandel noch als zentrale Einflussgröße.
Bei der Frage, wie viel Einfluss Mitarbeitende selbst auf technologische Veränderungen haben, zeigen sich Unsicherheiten. Ein Teil fühlt sich gut eingebunden, während andere kaum das Gefühl haben, den Wandel mitgestalten zu können.
Positive Stimmung trotz steigender Wechselabsichten
Obwohl sich viele Beschäftigte mit ihrer Arbeit identifizieren und die Aufgaben als sinnvoll empfinden, nimmt die Bereitschaft zu einem Jobwechsel nicht ab. Ein großer Teil der Befragten denkt über Veränderungen nach. Erschöpfung, Überforderung und unzureichende Bezahlung sind zentrale Gründe für die wachsende Mobilität. Vor allem das Thema Gehalt spielt eine wichtige Rolle, da im vergangenen Jahr nur ein kleinerer Teil der deutschen Beschäftigten eine Erhöhung erhalten hat.
Die Bedeutung von Vertrauen und Orientierung
PwC-Experte Till Lohmann weist darauf hin, dass Unternehmen in Phasen schnellen Wandels nicht nur auf technische Lösungen setzen dürfen. Vertrauen, transparente Kommunikation und gezielte Weiterbildung entscheiden darüber, ob Mitarbeitende motiviert bleiben. Zwar ist das Verhältnis zur direkten Führungskraft in vielen Unternehmen gut, doch das Vertrauen in das obere Management fällt geringer aus.
Auch bei der Innovationskultur gibt es Luft nach oben. Im internationalen Vergleich wagen deutsche Beschäftigte etwas seltener, neue Ideen auszuprobieren oder Fehler offen anzusprechen.
Die Studie zeigt außerdem, dass viele Beschäftigte nicht ausreichend Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Weniger als die Hälfte hat im vergangenen Jahr Fähigkeiten erworben, die ihre Karriere langfristig stärken könnten. Unterstützung durch Führungskräfte wird ebenfalls nicht überall als selbstverständlich empfunden.
Trotz dieser Herausforderungen blicken viele Mitarbeitende optimistisch in die Zukunft. Daniela Geretshuber von PwC Deutschland betont, dass Führungskräfte diesen Optimismus nutzen sollten, um Lernbereitschaft zu fördern und Weiterentwicklung zu ermöglichen.