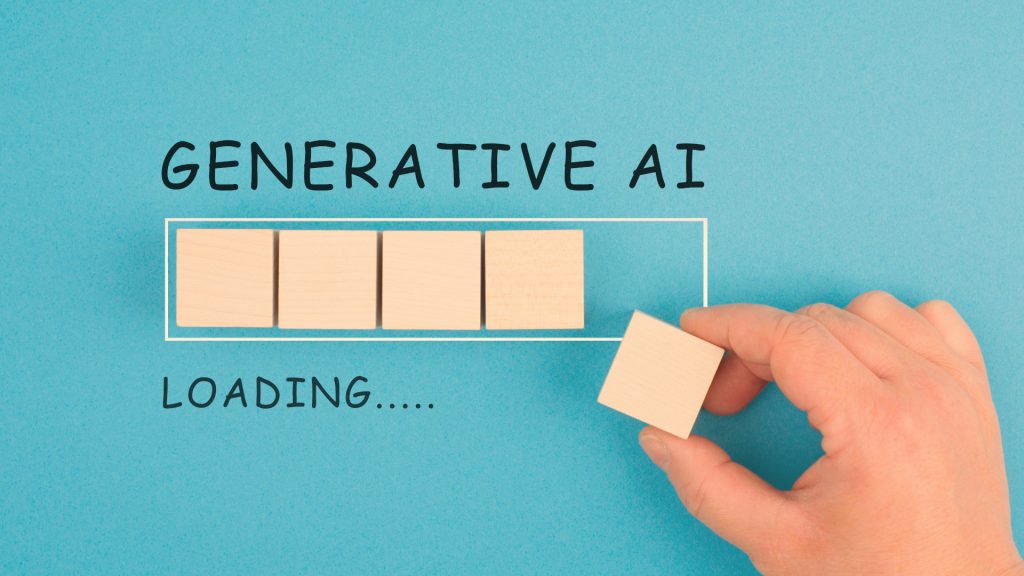Der deutsche Mittelstand steht an einem Punkt, den man aus der Evolution kennt: Einige Unternehmen wagen den Schritt in neues Terrain, andere beobachten lieber, wie es für die Pioniere ausgeht. Ähnlich ist es beim Thema Künstliche Intelligenz.
Viele sprechen darüber, doch nur wenige nutzen sie konsequent. Besonders deutlich zeigt sich das bei Generative AI (GenAI) – also Anwendungen, die eigenständig Inhalte wie Texte, Bilder oder Code erzeugen. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren und Wissen verfügbar zu machen.
Trotz des Potenzials herrscht Zurückhaltung. Viele beobachten und warten auf den „richtigen Moment“. Doch genau dieses Abwarten kostet Geschwindigkeit und letztlich die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.
Zwischen Aufbruch und Abwarten
In der Praxis zeigt sich, wie schwer der nächste Schritt fällt: Zuerst braucht es die Entscheidung, überhaupt zu starten und danach den Mut, vom Ausprobieren zum Anwenden zu gehen. Viele mittelständische Unternehmen haben GenAI bereits getestet, oft mit guten Ergebnissen. Doch was passiert dann? In der Praxis oft noch wenig. Aus erfolgreichen Pilotprojekten wird selten ein Produktivbetrieb. Prozesse bleiben in Excel hängen, Ideen in PowerPoint.
Das Problem: Als Firstmover ist die Chance zu scheitern größer. Unternehmen warten lieber, bis etwas ausgereift ist. Doch bei einer sich rasant entwickelnden Technologie führt genau dieses Warten dazu, dass Erfahrungen fehlen und die Lernkurve ausbleibt.
Genau hier entscheidet sich, wer das notwendige Killer-Mindset besitzt, also die Entscheidung, Risiken nicht zu meiden, sondern als Überlebensstrategie zu verstehen. Wie in der Evolution gilt auch hier das Prinzip des survival of the fittest: Nicht der Größte oder Reichste setzt sich durch, sondern der, der sich am schnellsten anpasst und lernt.
Laut einer aktuellen Studie halten 91 Prozent der deutschen Unternehmen generative KI inzwischen für geschäftskritisch, mehr als 80 Prozent wollen ihre Budgets deutlich erhöhen. Trotzdem bleibt der Fortschritt oft auf den Pilotrahmen beschränkt. Die entscheidende Hürde liegt in der Geschwindigkeit des Lernens. Wer zu spät experimentiert, lernt zu langsam und überlässt den Markt anderen.
Anpassung als Erfolgsfaktor
In wirtschaftlichen Umbruchphasen gelten daher ähnliche Regeln wie in der Natur: Wer sich schneller anpasst, überlebt. GenAI beschleunigt diese Entwicklung. Sie verändert Märkte nicht Schritt für Schritt, sondern sprunghaft. Geschäftsmodelle, die gestern stabil waren, können morgen überholt sein.
Das Killer-Mindset im Mittelstand bedeutet deshalb: Lernen, bevor man muss. Anpassung bedeutet dabei nicht, jeder neuen Technologie hinterherzulaufen, sondern die eigene Umsetzungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Unternehmen, die früh mit kleinen, kontrollierten Projekten beginnen, entwickeln Routinen im Umgang mit KI. Diese Fähigkeit zum Ausprobieren und Skalieren entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit. Während manche noch abwägen, wie sie GenAI „richtig“ einsetzen, automatisieren andere bereits ihre ersten Prozesse und verschaffen sich so Wissensvorsprünge.
Chamäleon und Werkzeug zugleich
Kaum eine Technologie ist so anpassungsfähig wie GenAI: In der einfachsten Form unterstützt sie als digitaler Assistent – sie erstellt Protokolle, analysiert Dokumente oder beantwortet Routinefragen. Solche Anwendungen sparen Zeit und schaffen Freiraum für Aufgaben, die menschliches Urteilsvermögen erfordern.
Im erweiterten Einsatz wird sie zum strategischen Werkzeug: KI-Systeme analysieren Verträge, simulieren Szenarien oder schlagen neue Geschäftsmodelle vor. Sie verändert, wie Arbeit verteilt, Wissen genutzt und Entscheidungen getroffen werden. Das ist zum Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie gut sie in bestehende Strukturen eingebettet ist.
Vom Pilot zum Produkt
Viele Unternehmen verharren dabei im Testmodus. Der entscheidende Schritt fehlt: aus einem erfolgreichen Versuch ein funktionierendes System zu machen. Dieser Übergang gelingt nur, wenn KI als Teil des Kerngeschäfts verstanden wird.
Wie das konkret aussehen kann, zeigen zwei Beispiele aus der Praxis, die ich begleiten durfte: Ein Team von Ingenieur:innen in der Produktion hat gemeinsam mit einem KI-Copiloten gearbeitet, der sie zu den passenden Ersatzteilen oder geeigneten Alternativen führt und so Stillstandzeiten deutlich reduziert. Und ein Kundenservice-Team hat zusammen mit GenAI einen technischen Produktassistenten konzipiert, der Kund:innen bei der Installation industrieller Produkte besser berät, was die Abschlussquote im Vertrieb erhöht.
Dazu braucht es klare Ziele, Verantwortung und Messgrößen. Ein Pilotprojekt darf kein Selbstzweck sein, sondern muss Antworten liefern: Welches Problem wird gelöst? Welche Routine wird effizienter?
Aus der Praxis lassen sich vier Prinzipien ableiten:
- Handeln – starten, statt analysieren.
- Testen – klein beginnen, aber messbar.
- Verbessern – Feedback nutzen, Prozesse anpassen.
- Skalieren – Erfolge standardisieren und ausweiten.
Entscheidend ist Kontinuität: lieber in Bewegung bleiben, als auf den idealen Zeitpunkt zu warten. Wer diese Haltung etabliert, legt fest, auf welcher Seite des Wandels das Unternehmen steht.
Tempo schlägt Größe
Unternehmen stehen vor der Wahl, Technologien aktiv zu gestalten oder sich von ihnen treiben zu lassen. Wer früh handelt, entwickelt Strukturen, die sich anpassen können.
KI ersetzt dabei keine Menschen, sie ersetzt Stillstand. Sie übernimmt Routinen, damit Mitarbeitende mehr Zeit für Analyse, Kundenkontakt und Entwicklung haben. Gefährlich wird es, wenn genau diese Stärken durch Zögern blockiert werden. Der entscheidende Faktor ist nicht mehr Größe oder Kapital, sondern Geschwindigkeit und die Fähigkeit, Prozesse und Entscheidungen schnell weiterzuentwickeln.
Das Killer-Mindset ist die Denkweise, die über die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands entscheidet. Um es nochmal mit Darwins Worten deutlich zu machen: Es überlebt nicht die stärkste Spezies, sondern die, die sich am besten an den Wandel anpasst. Daher mein Appell: Fangt jetzt mit GenAI in euren Unternehmen an!