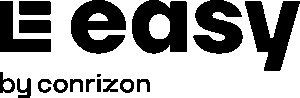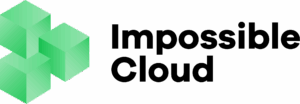Microservices und Multi-Cloud gelten als moderne Idealarchitekturen. Doch in vielen Unternehmen erzeugen sie vor allem Komplexität und Kosten. Warum ein pragmatischer Mittelweg aus modularen Strukturen oft die nachhaltigere Wahl ist.
Wenn das Cloud-Versprechen bröckelt
Kaum ein Architekturthema wurde in den vergangenen zehn Jahren so stark normativ aufgeladen wie Cloud-Native-Design. Microservices, Container-Orchestrierung und Multi-Cloud-Strategien galten lange als Synonym für Zukunftsfähigkeit. Wer sie nicht einsetzte, riskierte den Ruf technologischer Rückständigkeit. Inzwischen zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild: Viele IT-Organisationen stellen in den letzten Jahren fest, dass ihre Systemlandschaften zwar hochgradig modern wirken, operativ aber immer schwerer zu beherrschen sind.
Dabei spricht die Verbreitung zunächst für sich: Neun von zehn Unternehmen weltweit verfolgen Studien zufolge eine Multicloud-Strategie und kombinieren beispielsweise AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Gleichzeitig wächst jedoch der Zweifel, ob diese Komplexität in jedem Fall einen echten Mehrwert liefert. Immer mehr Organisationen prüfen daher, welche Workloads sie bewusst wieder in private Umgebungen oder ins eigene Rechenzentrum zurückholen. Das ist weniger eine Rolle rückwärts als vielmehr ein Zeichen wachsender architektonischer Reife.
Die Microservices-Falle
Microservices sind kein Allheilmittel, ihr Nutzen entsteht unter klaren Voraussetzungen: unabhängige Teams, klar geschnittene fachliche Domänen, stark divergierende Skalierungsanforderungen und eine hohe operative Reife im Betrieb verteilter Systeme. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kippt der Ansatz schnell.
In der Praxis zeigt sich das an wiederkehrenden Symptomen: Ein einzelner Geschäftsprozess zieht sich durch zahlreiche Services, Deployments müssen koordiniert werden und einfache Änderungen erfordern tiefes Systemverständnis über Teamgrenzen hinweg. Observability wird zum eigenen Projekt, Debugging zur Schnitzeljagd. Was als Entkopplung gedacht war, endet in enger Abstimmung und steigender Fehleranfälligkeit.
Hinzu kommen ökonomische Effekte: Netzwerkkommunikation, Orchestrierung, Managed Services und komplexe Abrechnungsmodelle erzeugen laufende Kosten, die mit wachsender Nutzung nicht linear, sondern häufig sprunghaft steigen. Viele Organisationen überschreiten ihre Cloud-Budgets genau aus diesen Gründen um rund zehn bis fünfzehn Prozent. Gerade bei stabilen, gut planbaren Workloads stellt sich dann die Frage, ob die verteilte Architektur ihren Preis noch rechtfertigt.
Der modulare Monolith als Mittelweg
Für viele Unternehmen liegt die tragfähige Lösung zwischen den Extremen. Der modulare Monolith verbindet die Vorteile beider Welten: einfache Deployments und geringere operative Komplexität auf der einen Seite, klare fachliche Trennung und Weiterentwickelbarkeit auf der anderen.
Zentral sind dabei einige Prinzipien: Module müssen klar geschnitten und über stabile interne Schnittstellen verbunden sein. Abhängigkeiten folgen einer eindeutigen Richtung, zyklische Kopplungen werden vermieden. Die Struktur orientiert sich an fachlichen Domänen und Geschäftsprozessen, nicht an technischen Schichten oder Tools. So bleibt das System verständlich, testbar und schrittweise erweiterbar.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass auch der modulare Monolith nicht das Allheilmittel für funktionierende IT-Architekturen ist. Komponenten mit stark abweichenden Lastprofilen, besonderen Sicherheitsanforderungen oder echtem Bedarf an Teamautonomie können und sollten weiterhin ausgelagert werden. Der Unterschied liegt in der bewussten Entscheidung. Denn nicht jede technische Möglichkeit muss genutzt werden, nur weil sie verfügbar ist.
Architektur als Organisationsfrage
Ein oft unterschätzter Aspekt ist die enge Kopplung von Architektur und Organisation. Systeme spiegeln die Kommunikationsstrukturen ihrer Teams wider. Wenn mehrere Gruppen ohnehin jede Änderung gemeinsam abstimmen müssen, erzeugt eine verteilte Architektur keinen Freiheitsgewinn. Umgekehrt kann echte Teamautonomie eine stärkere technische Entkopplung rechtfertigen.
Auch die operative Reife spielt eine Rolle. Verteilte Systeme verlangen nach belastbaren Betriebsmodellen: 24/7-Bereitschaften, saubere Incident-Prozesse, ausgereifte Observability. Fehlen diese Voraussetzungen, wird Komplexität schnell zum Risiko. Ein konsolidierter Ansatz ist in solchen Fällen oft robuster und im Ernstfall leichter wiederherzustellen.
Fazit: Weniger Dogma, mehr Handwerk
Die Cloud hat versprochen, IT einfacher zu machen. In vielen Organisationen beobachten wir jedoch das Gegenteil: Anstatt Komplexität zu reduziert, wird sie eingekauft. Teure Managed Services kompensieren schlechtes Design, zusätzliche Plattformschichten überdecken fehlende Klarheit in der Domänenstruktur. Die Architektur wird so zum Ablasshandel: Man bezahlt für Komfort, ohne die strukturellen Probleme zu lösen. Das Ergebnis ist die Legacy von morgen: Hochverteilte Cloud-Architekturen, die heute als modern gelten, sind in zwei oder drei Jahren so komplex geworden, dass sie kaum noch jemand wirklich versteht.
In einem ausgeprägten Technologie-Dogmatismus ersetzen Buzzwords ökonomische Argumente und Architekturentscheidungen werden trendgesteuert getroffen, anstatt sich auf die Geschäftsanforderungen zu fokussieren. Um das zu verhindern, müssen Unternehmen verstehen, dass Architektur kein Glaubensbekenntnis ist. Sie ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung mit langfristigen Konsequenzen für Kosten, Geschwindigkeit und Risiko.
Zukunftsfähige Architekturen zeichnen sich nicht durch maximale Modernität, sondern durch Angemessenheit und Praxistauglichkeit aus. Sie lassen sich neuen Mitarbeitenden erklären, wachsen mit den fachlichen Anforderungen und bleiben wirtschaftlich beherrschbar. Vor allem ist der Abschied vom Schwarz-Weiß-Denken wichtig: Nicht alles muss Microservice sein und nicht alles gehört in die Cloud. Entscheidend ist, die eigene Architektur wieder als Werkzeug zu begreifen und nicht als allumfassendes Glaubensbekenntnis.