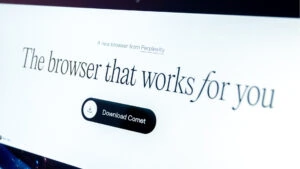Cloud Object Storage gehört seit Jahren zu den Standardbausteinen moderner IT-Infrastrukturen. Die meisten Unternehmen orientieren sich am etablierten S3-Modell, das Amazon Mitte der 2000er geprägt hat.
Dieses Modell sieht eine klare Trennung verschiedener Speicherklassen vor: häufig genutzte Daten liegen im schnellen Zugriff, selten genutzte Inhalte werden in günstigere, langsamere Tiers verschoben. Lifecycle-Regeln sorgen dafür, dass Objekte nach einem definierten Zeitraum automatisch verschoben werden. Dazu kommen Zugriffsrechte und Policies, die einen differenzierten Umgang mit Daten ermöglichen sollen.
Auf dem Papier wirkt dieser Ansatz logisch. Er verbindet Performance mit Kostenersparnis, indem er Daten nach ihrer Nutzungshäufigkeit aufteilt. Doch im Alltag zeigt sich: Die Theorie ist oft nur eingeschränkt praxistauglich. IT-Teams kämpfen mit komplexen Regeln, schwer kalkulierbaren Kosten und unerwarteten Verzögerungen im Betrieb.
Warum Tiering eingeführt wurde – und warum es heute Probleme schafft
Tiering hatte lange Zeit eine klare Berechtigung. Speicher war teuer, und die Auslagerung seltener Daten in günstigere Klassen versprach Einsparungen. Mit dem massiven Preisverfall für Storage und den gestiegenen Anforderungen an Datenverfügbarkeit kippt diese Rechnung jedoch zunehmend.
Ein Beispiel: Viele Unternehmen definieren Lifecycle-Regeln nach dem Prinzip „nach 30 Tagen ohne Zugriff ins Archiv verschieben“. Das funktioniert, solange die Daten tatsächlich nicht mehr benötigt werden. Sobald aber ein Analyse-Tool, ein Reporting-Prozess oder eine Compliance-Anfrage auf alte Daten zugreift, werden diese Regeln zum Hindernis. Daten liegen im Archiv, müssen zeitaufwendig zurückgespielt werden und verursachen Kosten, die im Vorfeld kaum einplanbar sind.
Besonders problematisch ist das bei Archiven wie Glacier oder Deep Archive. Hier dauert ein Restore nicht selten mehrere Stunden. Gleichzeitig entstehen Gebühren, die schnell ein Vielfaches der ursprünglichen Speicherkosten ausmachen. Für Anwendungen, die sofortige Antworten erwarten, bedeutet das: Timeouts, Fehlermeldungen und abgebrochene Workflows. In produktionsnahen oder zeitkritischen Szenarien kann das gravierende Folgen haben – von Verzögerungen bis hin zu Geschäftsausfällen.
Ein weiterer Nachteil des Tierings ist seine mangelnde Transparenz. Unternehmen kalkulieren oft mit den reinen Speicherkosten und übersehen dabei Abrufgebühren, Mindesthaltedauer oder Egress-Kosten. Diese „versteckten“ Posten schlagen jedoch genau dann zu, wenn Daten kurzfristig benötigt werden.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Unternehmen lagert ältere Kundendaten in eine Cold-Klasse aus. Monate später wird im Rahmen einer Revision auf diese Daten zugegriffen. Der Restore dauert Stunden, verursacht zusätzliche Abrufgebühren und blockiert parallel laufende Prozesse. Das IT-Team sieht sich plötzlich mit Budgetüberschreitungen und unzufriedenen Fachbereichen konfrontiert – obwohl die ursprüngliche Speicherstrategie eigentlich Kosten senken sollte.
Always-Hot statt Klassenlogik
Immer mehr IT-Verantwortliche stellen deshalb die Grundannahme des Tierings infrage. Statt Daten nach Nutzungshäufigkeit in unterschiedliche Speicherklassen zu verschieben, setzen sie auf Architekturen, die alle Objekte jederzeit im direkten Zugriff halten. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es gibt keine Restore-Prozesse, keine Wartezeiten und keine unvorhersehbaren Zusatzkosten. Alle Daten stehen permanent zur Verfügung, unabhängig davon, wie oft sie tatsächlich genutzt werden. Für Unternehmen bringt das mehr Planbarkeit. Ob Backups, langfristige Archive oder Analysen mit wechselnden Zugriffsmustern – die Performance bleibt konsistent, und die Kosten lassen sich klar kalkulieren. Komplexe Lifecycle-Regeln entfallen, was den Betrieb deutlich vereinfacht.
Die Wahl der Speicherarchitektur ist mehr als eine Kostenfrage.
Lennart Rother, Impossible Cloud
Ein Speicher, der Daten jederzeit verfügbar macht, braucht zugleich eine robuste Zugriffskontrolle. Klassische S3-Mechanismen mit Bucket Policies und ACLs bieten zwar Flexibilität, erweisen sich aber bei vielen Buckets und komplexen Organisationen oft als unübersichtlich. Moderne Systeme setzen daher auf identitätsbasierte Zugriffskontrolle (IAM). Rechte werden granular pro Nutzer oder Objekt vergeben, und Aktionen wie Lesen, Schreiben oder Löschen sind klar definierbar. Gerade in Multi-Tenant-Umgebungen sorgt das für Übersicht und Sicherheit.
Neben der Backend-Logik spielt die Bedienoberfläche eine entscheidende Rolle. IT-Teams benötigen eine zentrale Konsole, in der sie Rechte, Rollen und Freigaben steuern können, ohne tief in APIDokumentationen einzutauchen. Dazu gehören auch temporäre Freigaben über presigned URLs, Monitoring- und Logging-Funktionen sowie die Möglichkeit, Migrationen effizient zu verwalten. Eine gute Oberfläche ist damit nicht nur Komfort, sondern Voraussetzung für reibungslose Abläufe.
Rechtliche und regulatorische Anforderungen
Parallel zu den technischen Fragen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen ein weiterer Treiber für neue Speicherstrategien. Unternehmen wollen ihre Daten nicht nur performant, sondern auch rechtskonform verwalten. DSGVO-Konformität, europäische Datensouveränität und Schutz vor extraterritorialen Gesetzen wie dem US CLOUD Act sind zentrale Kriterien bei der Auswahl von Speicherlösungen.
Hinzu kommen branchenspezifische Vorgaben. Banken und Versicherer müssen strenge Audit- und Aufbewahrungspflichten erfüllen, produzierende Unternehmen achten auf Nachvollziehbarkeit und Lieferketten-Sicherheit, im Gesundheitswesen geht es um Vertraulichkeit und Zugriffsrechte. Ein Object Storage, der Verschlüsselung, Mandantenfähigkeit und standardisierte APIs bereitstellt, ist hier mehr als ein technisches Detail, er ist eine Grundvoraussetzung für die Compliance.
Speicher als Teil der Resilienz-Strategie
Der Blick nach vorn zeigt: Datenmengen wachsen weiter exponentiell, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit. Unternehmen können es sich immer weniger leisten, Daten erst wiederherstellen zu müssen oder in unübersichtlichen Speicherklassen zu verlieren.
Always-Hot-Ansätze passen daher in eine breitere Strategie: Sie sind ein Baustein für resiliente IT-Architekturen, die Ausfälle vermeiden, Kosten planbar halten und regulatorische Vorgaben einhalten. Statt Speicher in komplexe Klassen zu unterteilen, rückt das Prinzip in den Vordergrund, dass jede Information jederzeit verfügbar sein muss – egal, ob für den täglichen Betrieb, für Audits oder für unvorhersehbare Analysen.
Das klassische Tiering-Modell stößt in der Praxis immer häufiger an seine Grenzen. Seine Komplexität, die Abhängigkeit von Regeln und die schwer kalkulierbaren Kosten machen es für viele Unternehmen unattraktiv. Speicherlösungen, die Daten dauerhaft verfügbar halten, reduzieren diese Risiken und schaffen mehr Transparenz. Für IT-Entscheider gilt daher: Die Wahl der Speicherarchitektur ist mehr als eine Kostenfrage. Wer auf direkte Verfügbarkeit, klare Zugriffskontrollen und rechtskonforme Infrastruktur setzt, schafft die Grundlage für eine zukunftssichere IT.